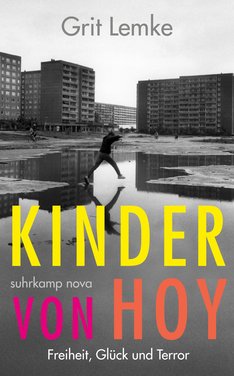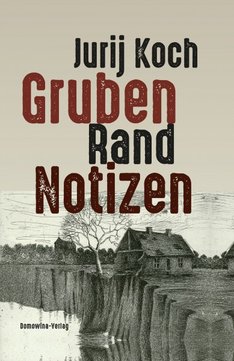Texte im Überblick
Cheikh Anta Diop - Wider die Arroganz des Abendlandes
(Beitrag im neuen deutschland, 28.12.2023)
Über tragbare Bildung in Hoyerswerda. Grit Lemkes "Kinder von Hoy"
(Rezension in "Das Blättchen", 27.9.2021)
" ... ein bisschen feiner strukturiert der Wahnsinn" Zu Jurij Kochs "Gruben-Rand-Notizen"
(Rezension in "Das Blättchen", 10.5.2021)
Die Sorbin auf der Ravensbrück-Briefmarke. Zum 125. Geburtstag von Marja Grólmusec
(Artikel im nd, 22.4.2021)
Man braucht mehr als die reine Ästhetik. Zum Tod des Schauspielers Heinz Klevenow, der in Senftenberg das Theater gerettet hat
(Nachruf für das nd, 9.3.2021)
Hansdieter Neumann (1934-2021)
(Nachruf, 3.2.2021)
"Hana. Eine jüdisch-sorbische Erzählung" von Jurij Koch
(Buchbesprechung, 11.12.2020)
Strukturwandel in der Lausitz und die Arbeit der RLS Brandenburg
(Beitrag auf der RLS-BB-Mitgliederversammlung, 11.5.2019)
Entnennung und Entpolitisierung. Isabella Greif und Fiona Schmidt über den staatsanwaltschaftlichen Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt
(Rezension im nd neues, 23.3.2018)
Kwame Nkrumah und der Kalte Krieg
(Artikel in Das Blättchen, 1.1.2018)
Jenseits des Weltschmerzes - Die »Ostrale« in Dresden verzeichnete 2016 einen Besucherrekord. Wie es weitergeht, ist offen
(Artikel im nd, 9.1.2017)
Ein „Windrad auf dem Dach“ für Jurij Koch
(Beitrag in Das Blättchen, 2.1.2017)
In der Sonne von Bozen. Das Siegesdenkmal in Bozen uns sein Dokumentationszentrum als Versuch, die komplexe Geschichte des Faschismus in Südtirol zu verarbeiten
(Artikel in Volksstimme, 27.10.2016)
Senftenberg ist Zły Komorow, nur beschlossen ist es (noch) nicht
(Kommentar zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, 9.3.2016)
Zły Komorow: Warum Senftenberg zum angestammten sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet gehört
(Argumentationshilfe, 7.12.2015)
"Manifestliches" im Theater am Rand
(Rezension in Das Blättchen, 12.10.2015)
Entdeckung eines Bekannten: "Sterne glühn" - Hans-Eckardt Wenzel hat Gedichte von Johannes R. Becher vertont
(Rezension im nd, 1.10.2015)
Das Theater im Revier und Heinz Klevenow
(Beitrag in Das Blättchen, 28.9.2015)
„Zabyś“ und „zabis“ - Wendischer Nachmittag in Senftenberg
(Artikel im Nowy Casnik, 2.9.2015)
Weltgeschichte und Bilder aus der Provinz. Warum dieses Thema? Warum in der NEUEN BÜHNE Senftenberg?
(Referat zur Konferenz „PROVINZ VERSUS PROVINZIALITÄT“, 4.6.2015)
Das war ein Angriff auf ein immer wieder neu einzulösendes Freiheitsideal
(Beitrag für die RLS Brandenburg anlässlich der Angriffe auf Charlie Hebdo, 11.1.2015)
Das Recht auf Anderssein - Philosophische und praktisch-politische Überlegungen zur Sorben/Wenden-Politik in Brandenburg
(Vortrag, 6.12.2014)
Verpflichtung zur Pflege sowjetischer Gedenkstätten
(Gedanken und Anregungen, 15.5.2012)
Einigungsvertrag und Kulturpolitik im Land Brandenburg. Ein Kommentar
(Studie, 1.9.2010)
Cheikh Anta Diop - Wider die Arroganz des Abendlandes
Vor 100 Jahren wurde der afrikanische Universalgelehrte Cheikh Anta Diop geboren
Beitrag von Gerd-Rüdiger Hoffmann in "neues deutschland" am 28. Dezember 2023
Er habe den Afrikanern ihr historisches Bewusstsein zurückgegeben, heißt es über Cheikh Anta Diop. Für diese Einschätzung gab und gibt es gute Gründe, obwohl seine zentralen Thesen in einigen Punkten mehr Spekulation als empirisch gesichertes Wissen bieten. Sie lauten: Erstens, Afrika ist durch eine kulturelle Einheit gekennzeichnet und zweitens sei die altägyptische Kultur negroiden Ursprungs und drittens habe die antike griechische Philosophie fast nahtlos altägyptisches Denken übernommen. Daraus ergab sich für Diop die Konsequenz der Rückkehr zu den Quellen, also um die Rückbesinnung auf altägyptische Kultur negroiden Ursprungs. Heute würde dieses Herangehen wahrscheinlich mit dem Begriff Afrofuturismus bezeichnet werden.
Cheikh Anta Diop wurde am 29. Dezember 1923 in Thieytou, einem kleinen senegalesischen Dorf in der Nähe von Diourbel, als Sohn einer muslimischen Wolof-Familie geboren. Die Schulausbildung erfuhr er sowohl in Koranschulen als auch in katholisch geprägten Schulen der Kolonialmacht Frankreich. Sein in Dakar begonnenes Physikstudium setzte er in Paris fort. Zudem studierte er an der Pariser Sorbonne Geschichte und Ethnologie, unter anderem bei Marcel Griaule. 1954 erschien bei Présence Africaine sein Buch »Nations nègres et culture«, das als klassisches Werk der »afrikanischen Authentizität« gilt. Bis 1960 in Paris tätig, war er anschließend in Senegal Mitbegründer und Führer mehrerer oppositioneller Parteien. Der Rassemblément National Démocratique (RDA) wurde zu einer der stärksten Oppositionsparteien in Senegal. Bekannt ist Diop vor allem als Historiker, Physiker und Kulturtheoretiker, wegen einiger kühner Thesen besonders umstritten als Ägyptologe. Cheikh Anta Diop starb am 7. Februar 1986 in Dakar.
Obwohl sich viele seiner Ansichten nicht belegen lassen, beispielsweise die Kongruenz von ägyptischen und afrikanischen Göttern, wurde Diop zum Symbol für das Emanzipationsstreben der Wissenschaft in Afrika. Im Kontext der Kolonialgeschichte, der vom Paternalismus geprägten Missionierung ebenso wie der Hegelschen Auffassung von der Geschichtslosigkeit Afrikas war das nur zu verständlich. Die Ignoranz und – schlimmer noch – Herabwürdigung jeglicher Leistungen von Afrikanerinnen und Afrikanern prägte die Geschichtsschreibung seit der Antike. Herrschte in der Antike noch großes Unwissen über die Kulturen südlich der Sahara gab es jedoch immer wieder Kontakte zum heutigen Äthiopien, Ägypten oder Nubien. Diese waren nicht konfliktfrei, von Barbaren war die Rede, zugleich wurden diese jedoch oft mehr oder weniger als Partner, Konkurrenten oder Feinde auf Augenhöhe betrachtet. »Auf Augenhöhe« bedeutete damals nicht wie heute vielfach, dass »die Anderen« erst auf den Stand »unserer Werte« gehoben werden müssten, bevor sie gleichberechtigt mit »uns« an einem Tisch sitzen dürfen. Davon legen die Historien von Herodot, auf die sich Diop bezieht, eindrucksvoll Zeugnis ab.
Cheikh Anta Diop wollte über möglichst exakte Forschungen, einschließlich naturwissenschaftlicher, den Nachweis erbringen, dass es Afrikanerinnen und Afrikaner waren, die entscheidende Beiträge für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation erbrachten. Mit konkreten Vorschlägen wollte er als Wissenschaftler und Politiker dazu beitragen, dass Afrikanerinnen und Afrikaner selbstbewusst auf ihre Geschichte blicken und ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten. In Afrika, betonte Diop zu Recht, gab es ähnliche hochentwickelte Zivilisationen wie nördlich des Mittelmeers mit effektiven Verwaltungsstrukturen, raffinierten Technologien und starken Machtapparaten, zum Beispiel Aksum wie auch in Benin, Ghana, Simbabwe und vor allem in Ägypten. Es gäbe demnach keinen Grund, die Geschichte Afrikas lediglich als eine Geschichte von einzelnen isolierten »Stämmen« zu betrachten und damit die kulturelle Einheit des Kontinents komplett zu ignorieren. Diop setzte sich für einen neuen Panafrikanismus ein. Dazu gehöre auch, die afrikanischen Sprachen als anderen Sprachen ebenbürtig zu behandeln. Er regte Lehrpläne an, deren Inhalte schon in Kindergärten und Grundschulen koloniale Sichtweisen und Strukturen sowie die Kommunikation ausschließlich in den angeblich einzig modernen Erfordernissen entsprechenden Sprachen der Kolonialmächte überwinden sollten. Als Beweis dafür, dass afrikanische Sprachen hochkomplexe Sachverhalte wiedergeben können, übersetzte Diop Auszüge aus Albert Einsteins Relativitätstheorie in seine Muttersprache Wolof.
Interessant an Diops Schriften ist das Fehlen eines abstrakten Begriffs von Freiheit. Freiheit war für ihn konkret, beinhaltete den aktiven Aspekt der politischen Befreiung. Dieses Herangehen und seine Überlegungen und Vorschläge zur sozialen Struktur afrikanischer Gesellschaften und der ökonomischen Entwicklung brachten ihm den Ruf eines Marxisten ein. Bereits 1954 schrieb er im Vorwort zur Erstausgabe seines Hauptwerkes zu seinem methodischen Vorgehen sinngemäß, dass er sich keine Fragen zu wünschenswerten Antworten ausgedacht hätte. Um Analyse und nicht um Bekenntnisse ginge es ihm also. Diop selbst meinte: »Wer den Marxismus als Leitfaden für sein Handeln auf afrikanischem Terrain nutzt, wird im Wesentlichen zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen.«
Ein noch weitgehend unbekanntes Feld der wissenschaftlichen Arbeit Diops sind seine Überlegungen zur afrikanischen Philosophie. Gerade hier werden allerdings auch seine theoretischen Schwächen sichtbar. Denn welcher Wahrheitsgewinn sollte sich ergeben, wenn philosophische Aussagen an Hautfarbe oder kollektive ethnische Merkmale gekoppelt werden? Andererseits ergibt sich durch den von Diop gegen Rassismus und Eurozentrismus propagierten Perspektivenwechsel ein erkenntnistheoretisch widerspenstiger Ansatz, der abgeschlossene Systeme ablehnt. Er kritisierte nicht nur entsprechende, aus Europa überlieferte, übernommende Theorien, sondern sah auch eigene, früher vertretene Thesen durchaus selbstkritisch. Für die Würdigung und kritische Auseinandersetzung der wissenschaftlichen Leistungen Cheikh Anta Diops gilt, was der Philosoph und ehemalige Kulturminister Benins Paulin Hountondji allgemein über afrikanische Philosophie schrieb: »Wir brauchen kein geschlossenes System, an dem wir alle kleben und das wir der restlichen Welt exhibitionistisch darstellen können. Nein, wir wollen den ruhelosen Zweifel, eine ungebremste Dialektik, die ab und an Systeme hervorbringt und diese schließlich dem Horizont neuer Wahrheiten empfiehlt.«
Cheikh Anta Diops Erbe mahnt, dem Wiederaufleben »abendländischer« Arroganz Einhalt zu gebieten. Den Parolen von einer »wertebasierten Weltordnung«, die für alle Staaten und Regionen der Welt als alleiniger Maßstab gelten soll, nicht zu widersprechen, liefe auf eine Verarmung intellektueller Debatten über die Zukunft in einer multipolaren Welt hinaus.
2016 hat das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Dakar zu einer Konferenz mit mehr als 150 Teilnehmern geladen, die sich mit den wirtschaftspolitischen Auffassungen Diops befasste. Ein Referent war der Senegalese Felwine Sarr, zu jener Zeit Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Université Gaston-Berger in Saint Louis, heute vor allem als Autor des gemeinsam mit Bénédicte Savoy verfassten Berichts über die Restitution afrikanischer Kulturgüter bekannt. Beispiel einer kollegialen Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wie es sich Diop gewünscht hatte.
#ndbleibt – Aktiv werden und Aktionspaket bestellen
Egal ob Kneipen, Cafés, Festivals oder andere Versammlungsorte – wir wollen sichtbarer werden und alle erreichen, denen unabhängiger Journalismus mit Haltung wichtig ist. Wir haben ein Aktionspaket mit Stickern, Flyern, Plakaten und Buttons zusammengestellt, mit dem du losziehen kannst um selbst für deine Zeitung aktiv zu werden und sie zu unterstützen.
Zum Aktionspaket
Zum 100. Geburtstag Diops betonten Vertreter des von ihm gegründeten RND als dessen Vermächtnis, dass sich alle senegalesischen und anderen afrikanischen Patrioten und Demokraten im Kampf um wahre politische, wirtschaftliche und kulturelle Befreiung des Landes und des Kontinents vereinen sollten.
Über tragbare kulturelle Bildung in Hoyerswerda
Rezension zu Grit Lemkes "Kinder von Hoy"
Beitrag von Gerd-Rüdiger Hoffmann in "Das Blättchen" am 27. September 2021
Grit Lemke, 1965 in Spremberg geboren, in Hoyerswerda (sorbisch Wojerecy) aufgewachsen, Dokumentarfilmerin, Autorin, Kuratorin und wichtige Stimme in der Lausitz, wenn es um die Präsentation und Förderung sorbischen Filmschaffens geht, hat am 19. September in der Kulturfabrik Hoyerswerda ihr Buch „Kinder von Hoy. Freiheit, Glück und Terror“ vorgestellt. Dass der große Saal der Kufa, wie in der Stadt mit der Vorliebe für Abkürzungen die Kulturfabrik nur genannt wird, bis zum letzten Platz besetzt sein wird, damit war zu rechnen. Dass zwei Lesungen an einem Tag notwendig werden, vielleicht auch noch. Dass Grit Lemke mit ihrem Buch fast wie ein Popstar gefeiert wird, wie es sich Volksvertreter vor allem in Wahlkampfzeiten wünschen würden, war für die Autorin dann wahrscheinlich doch eine Überraschung. Eine weitere Überraschung war, gestand die Autorin, dass sie in den zahlreichen Interviews gleich kurz nach Erscheinen des Buches als die Stimme von Hoyerswerda oder ähnlich wie Gundermann gleich für die gesamte Lausitz gefragt war. „Nein, das bin ich nicht“, gibt sie zu verstehen, denn „wir sind viele“ und präsentiert wie zum Beweis dafür eine szenische Lesung mit elf Beteiligten aus diesem Kollektiv.
Nach den Pogromen 1991 erlangte Hoyerswerda international traurige Berühmtheit. Neonazis proklamierten Hoyerswerda unter dem Beifall vieler Einwohner zur ersten ausländerfreien Stadt Deutschlands. Die nach 1990 Geborenen wissen nichts darüber, mussten sich damit auch nicht in der Schule beschäftigen. Eltern und Großeltern übten sich in Schweigen. Aus Scham? Oder einfach deshalb, weil sie keine Lust hatten, sich gegen die öffentliche Meinung, die oft nichts anderes als die von Spiegel oder BILD veröffentlichte Meinung ist, zu verteidigen? Grit Lemke geht anders an das Thema heran. Sie hat einen dokumentarischen Roman über Hoyerswerda aus bisher nicht dagewesener Perspektive geschrieben.
Die Lausitz – ihre Geschichte, die Landschaft, die Umbrüche durch Bergbau und Energiewirtschaft, der herbe Menschenschlag und nicht zuletzt der Konflikt zwischen gelebter und verdrängter sorbischer Tradition – hat immer wieder Stoff geboten für gute Literatur. Grit Lemke hat einen weiteren wichtigen Beitrag dazu geleistet. Ihr Buch dürfte zum Besten gehören, was in den letzten dreißig Jahren über den Osten geschrieben wurde.
Man wirft hier „nicht mit hohen Begriffen umher wie mit madigen Pflaumen“, heißt es bei Strittmatter. Der Satz könnte auch von Grit Lemke sein. Für meinen Schwiegervater Helmut, Jahrgang 1923, Wehrmachtssoldat und nach dem Krieg als Schlosser bis zum Lebensende mit heute für die Generation nach 1990 kaum verständlichem Stolz als Arbeiter ausgestattet, war Strittmatter einer „von uns“. „Die da sollen aufhören, dämliches Zeug über ihn zu quatschen.“ Gemeint war damit, „die Wessis verstehen uns nicht, müssen die auch nicht“. Für Helmut wäre Grit Lemke mit ihrem Buch wegen des Themas, ihrer Sprache und des wohlvertrauten Ortes eine von uns. Literatur in der Tradition des Bitterfelder Wegs also?
Ein energisches Nein und ein „um Gottes Willen“ wären verständlich, aber zu kurz gedacht. Denn zu erklären ist erstens, damit das heute verstanden wird, dass in den Hochhäusern von Hoyerswerda Ärzte, Maschinisten, Ingenieure, Krankenschwestern, Künstlerinnen und Philosophen, Bauarbeiter, Verkäuferinnen, Lehrerinnen, Direktoren, zur Bewährung entlassene ehemalige Strafgefangene und lokale Parteigrößen Tür an Tür wohnten. Zum Abitur strebende Kinder waren nicht separiert von jenen, die „normale“ Berufe anstrebten. Das „Behütet-Sein“, sagt Schudi im Roman von Grit Lemke, ging viel weiter als dieses „Helikopter-Ding“ von heute, „… mit vielen unterschiedlichen Menschen. Kinderkrippenerzieherinnen und Kindergärtnerinnen. Der Spielplatz. Die Nachbarn. Der Block, der Wohnkomplex, der Schulweg. Keine Sorge der Eltern, dass man über die Straße gehen muss. Sehr viel Vertrauen aller Erwachsenen in die Dinge, die da kommen – und in die Kinder. Ich bin schon zum Kindergarten alleine gegangen.“ Schließlich noch die Kittelschürzen: „Eine Kittelschürze ist alle Kittelschürzen. Hat man etwas ausgefressen, geht man besser jeder aus dem Weg. Hat man ein aufgeschlagenes Knie oder eine Rotznase, kann man sich an jede wenden.“
Zweitens muss der damalige Stellenwert von Kunst und Kultur in den heute als öde Kulisse in 20.15-Uhr-Kriminalfilmen stigmatisierten Plattenbauten betont werden. Röhli sagt im Roman: „Das war ja’n ganz komisches Ding in Hoyerswerda: Es gehörte zum guten Ton, eine tragbare kulturelle Bildung zu haben. Es gab … in jeder Wohnung bei uns im Haus, egal ob die Leute Schichtarbeiter waren oder Doktoren, das Bücherregal. Also ich kenn keene Wohnung ohne. Das musste man haben. Und man hat sich alles reingezogen, was da so rumstand.“
Spätestens hier muss etwas über die Sprache gesagt werden. Nicht nur, wenn Grit Lemke Leute aus Hoy, wie sie Hoyerswerda nennt, zitiert, lesen wir von der Koofhalle für Kaufhalle, ooch für auch, meenste für meinst du, zwee für zwei, keene für keine, ni für nicht, angescheuselt für schick angezogen usw. Und dann diese für Fremde schrecklichen, aber geradezu liebevoll gemeinten, Abkürzungen wie WK und GD für Wohnkomplex und Generaldirektor oder seltsame Worte wie Zwischenbelegung, große und kleine Hausordnung, nullte Stunde, rollende Woche, erste, zweete und dritte Schicht sowie die wahre Bedeutung von Ordnung Sicherheit Disziplin. Dazu kommen noch sorbische Wörter oder wenigstens das, was von ihnen im „Hoyerswerdschen Dialekt“ übrigblieb. Grit Lemke schildert starke Typen in ihrem dokumentarischen Roman und muss einfach ihre authentische Sprache präsentieren und damit auch ihr eigenes im Alltag benutztes Reden salonfähig machen. Sie trifft den Ton der Kinder von Hoy und ihrer Eltern. Oder nein, das ist eine zu schwache Aussage. Sie trifft den Sound einer Region und ihres Menschenschlags.
Figuren und Konflikte sind in einer Art zu Kunst verdichtet, die den besonderen Reiz dieses eigenwilligen Buches ausmacht. Das ist für einen dokumentarischen Roman mit eingebauten Interviews und Berichten über tatsächlich Geschehenes nichts Selbstverständliches. Man merkt, dass Grit Lemke vom Dokumentarfilm kommt. Der Roman folgt einer bis ins Letzte durchdachten Dramaturgie. Da ist Rhythmus in der Erzählweise, der das Buch zu einer runden und sehr gut lesbaren Geschichte macht. Der pädagogische Zeigefinger fehlt komplett, auch wenn die Sprache auf die rassistischen Ausschreitungen von 1991 kommt. Grit Lemke geht es nie darum, einen Beitrag zum Verständnis oder zur Rechtfertigung dessen zu leisten, was da geschehen war. Sie folgt auch nicht der momentanen Mode, in gerader Linie die Ursachen im Wesen der DDR zu suchen oder andersherum jeden Zusammenhang zur Stadtgesellschaft oder dem untergegangenen realen Sozialismus zu leugnen.
Sie schildert genau, aber eben von innen heraus, aus der Sicht einer Hoyerswerdschen und kritischen und gleichzeitig bekennenden ehemaligen DDR-Bürgerin, wie die Menschen hier „im ewigen Takt der Schichtbusse, der ein Ende nicht vorsieht“ lebten, wie sie als Erbauer von Schwarze Pumpe und der sozialistischen Planstadt Hoyerswerda vom Gedanken beseelt waren, dass mit ihnen die Geschichte erst beginnt, alles Zukunft war. Lange Zeit waren sich die Leute sicher, dass da noch etwas kommt. Nichts ist vorbei, es geht erst richtig los. Später dann wird klar: „Die Zukunft rückt immer weiter in die Ferne – obwohl sie doch näher kommen müsste.“ Noch später, nach 1989, ist die Zukunft „in einem großen Loch verschwunden“.
Die rassistischen Ausschreitungen tun ein Übriges. Grit Lemke beschreibt nicht einfach einen Vorgang vom Standpunkt des Zuschauers. Sie ist Teil des großen Kollektivs, aus dem das kam, und interessiert sich eben nicht bloß für eine Sache, sondern für die Schicksale von Menschen und erzählt sie uns. Wir lesen bei Grit Lemke: „Später, als Brandsätze in die Wohnheime der Ausländer fliegen und eine Menge sich vor ihnen versammeln und dazu jubeln wird, später wird es heißen, die Gewalt sei aus dem Nichts und von außen gekommen. Das wissen wir nun wirklich besser.“ Aber eine lehrbuchreine Erklärung wird es nicht geben. Grit Lemke bemüht sich auch gar nicht darum.
Mutig ist Lemkes Buch, weil ein Kollektiv der Hauptheld der Geschichte ist. „Kollektiv“ kann dann natürlich nicht in der heute üblichen abwertenden Bedeutung gemeint sein. Grit Lemke schafft es, eine Geschichte sehr unterschiedlicher Typen differenziert und genau zu erzählen. Sie gehen eben nicht in ein kollektives Einerlei auf, sondern werden erst in diesem Kontext zu interessanten Persönlichkeiten. Sie und viele der Leserinnen und Leser bekommen es mit der Frage zu tun, ob über das utopische Potential dieser Zeit überhaupt noch zu sprechen ist. Ich kann mir vorstellen, dass Grit Lemkes Buch bei neugierigen jungen Menschen, die die manchmal doch etwas verklärten Jugenderinnerungen ihrer Großeltern nicht mehr hören können, auf Interesse stößt. Und die Großeltern? Sie werden vielleicht ermuntert, sich anders zu erinnern, kritischer und dennoch nicht dem Druck ausgesetzt, sich einzusortieren als Opfer, Mitläufer oder Täter.
Grit Lemke: Kinder von Hoy. Freiheit, Glück und Terror, Suhrkamp 2021, 255 Seiten, 16,00 Euro
"... ein bisschen feiner strukturiert der Wahnsinn"
Rezension zu Jurij Kochs "Gruben-Rand-Notizen"
Beitrag von Gerd-Rüdiger Hoffmann in "Das Blättchen" am 10. Mai 2021
In der Nummer 1/2017 des Blättchens war darüber zu berichten, dass Jurij Koch ein Buch veröffentlicht hatte, das er ausdrücklich nicht „Tagebuch“, sondern „Erinnerungen“ nannte. Der Unterschied bestünde darin, dass Erinnerungen nicht unbedingt genau mit dem übereinstimmen müssten, was an diesem oder jenem Tag wirklich genau so und nicht anders geschehen sei, ein Tagebuch dagegen hält fest, was an einem bestimmten Tag war. Oder noch etwas genauer gesagt, ein Tagebuch beschäftigt sich damit, welches Ereignis oder welcher Gedanke zum Zeitpunkt des Geschehens als wichtig angesehen wurde, Erinnerungen damit, was im Nachhinein immer noch als wichtig und des Berichtens wert erscheinen mag. Erinnerungen an Ereignisse sind ohne Vergessen nicht denkbar und müssen nicht frei von nachträglichen Bewertungen sein. Der Unterschied also zwischen Erinnerungen und Tagebuch, das leuchtet ein, ist von Bedeutung. Nicht zuletzt zeigt sich dieser in Stil und Form. Nun also ein Tagebuch von Jurij Koch unter dem vielsagenden Titel „Gruben-Rand-Notizen“.
Für Liebhaber der meisterlichen Erzählkunst des Autors ist der Titel nicht überraschend. Die Idee, dass sich in der „Randerscheinung“, dem kleinen sorbischen Völkchen, Weltgeschehen und Weltprobleme in trefflicher Weise sinnlich erlebbar widerspiegeln und die Gruben der Bergbauindustrie nicht ewig als Symbole für Fortschritt gelten können und nicht nur eine Bedrohung für diese Minderheit darstellen, zieht sich wie ein roter Faden durch Romane, Erzählungen, Erinnerungen, Reden, Rundfunkbeiträge, Filme und Notizen von Jurij Koch. So ist es nicht verwunderlich, dass in seinem Tagebuch Selbstreflexion und Kritik der gesellschaftlichen Zustände und ihrer Ursachen zusammengehen. Die Welt anschauend bleibt Jurij Koch dem treu, was er bereits 1987 in seiner Rede auf dem 10. Schriftstellerkongress der DDR geradezu programmatisch ausgeführt hatte. Marx zitierend beharrte er bereits damals darauf, dass die Aufgabe einer Nation, ja selbst aller gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, darin bestehen müsse, die Erde den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Und Koch führte den Gedanken weiter aus, indem er bemerkte, dass er in jenem November des Jahres 1987 „die feierliche Abfahrt des ersten Kohlezuges im neuen Tagebau nicht als Erfolg“ begreifen konnte. Er „sah das absurde Bild von jubelnden Menschen auf dem Ast, an dem sie sägten“. Durch einen kleinen Trick ist diese widerborstige Rede ins Tagebuch unter dem Datum 19. September 1996, seinem 60. Geburtstag, aufgenommen. Mit anderen früheren Texten verfährt Jurij Koch ebenso und hat damit eine Reihe wirklich interessanter zeithistorischer Dokumente ins Tagebuch geholt, darunter auch einige, die heute nur noch schwer in Buchhandlungen zu finden sind.
Der erste Eintrag ins Tagebuch ist vom 28. April 1996. Es geht zunächst um ein läppisches Problem, nämlich darum, wie das Parken fremder Autos vor dem Tor der Familie Koch zu verhindern sei. Selbst eingesammelte große Feldsteine – so hieß die Lösung früher. Anders in den 1990er Jahren – man konnte die Steinzeitfindlinge aus dem Tagebau Jänschwalde für 29 Mark pro Tonne bei der Bergbauaktiengesellschaft kaufen. Jurij Koch veranlasst das zu folgender Tagebuchnotiz: „Wer hat Gesetze gemacht, nach denen ein Konzern mit eiszeitlichen Steinen Geschäfte machen darf? (…) Wir haben also ein Stückchen Schöpfung gekauft, die allen gehört, somit auch mir. Der Konzern verkaufte uns also unser Eigentum.“
Wer sich an die Zeit in der Lausitz kurz nach der Wende erinnert und Jurij Koch kennt, der ahnt, dass in den folgenden Tagebucheinträgen Horno zum beherrschenden Thema seiner Überlegungen wird. Über Horno ist nach dem Anklicken im Bruchteil einer Sekunde auf dem Bildschirm des Computers zu lesen: „Horno, niedersorbisch Rogow, war ein Dorf im Landkreis Spree-Neiße in der Niederlausitz im Südosten des Landes Brandenburg. Es lag im Gebiet des Braunkohletagebaus Jänschwalde und musste 2004 dem Tagebau weichen. Die meisten Einwohner siedelten nach Neu-Horno auf dem Gebiet der Stadt Forst (Lausitz) um.“
Ebenfalls am 28. April 1996 schreibt Jurij Koch in sein soeben begonnenes Tagebuch: „Nachmittags endlich Victor Klemperers ‚Tagebücher 1933 – 1941‘ vorgenommen.“ Sein Interesse wird zusätzlich angefacht, weil Klemperer unter dem Datum 22. März 1933 schreibt, dass „die brave Wendin Käthe“ bei Blumenfelds in Dresden als Dienstmädchen gekündigt habe, um eine „sichere Stelle“ anzunehmen. Koch weiß, dass Klemperer später noch intensivere Begegnungen mit Sorbinnen haben wird und teilt seinen Entschluss mit: „Ich werde auch ein Tagebuch schreiben.“ Und dann kommt der Satz, der nicht allen gefallen wird, weil sie die Judenverfolgung nicht mit der durch ein fossiles Gesellschaftsmodell verursachten Gefahr der ökologischen Krise und des Verschwindens der Sorben und ihrer Kultur verglichen haben wollen. Doch Jurij Koch schreibt: „Und es ist mir bei dem Beschluss, als erlebte ich ähnliche Zeiten wie Klemperer, ein bisschen feiner strukturiert der Wahnsinn, sodass er nicht auf Anhieb als Gefahr wahrgenommen wird.“ Doch was bei einigen seiner Altersgenossen als starrsinniges Beharren mit einer Prise Nostalgie daherkommt, ist bei Jurij Koch dann doch mehr ein Appell, selber nachzudenken. Und er bleibt der Mahner, wenn die Fortschrittsgläubigen mit Großprojekten kommen. So wird er sicher Recht behalten mit der Annahme, dass „die Seenbildung in der Lausitz eine Illusion bleiben wird, weil das benötigte Wasser […] nicht aufzutreiben sein wird“ (30. Juni 2003).
Auch so manch auf den ersten Blick bloß witziger Satz, wie zum Beispiel „In der DDR wurde ehrlicher gelogen“, erfährt beim nochmaligen Lesen eine analytische Dimension. Gut, bereits das damalige Zentralorgan Neues Deutschland bescheinigte Jurij Koch am 26. November 1987 in seinem Bericht über die bereits erwähnte Rede ein dialektisches Herangehen. Lediglich eine, dazu noch eine „verordnete“, Perspektive der Betrachtung war seine Sache nie. Da blieb sich Koch treu. So notiert er am 23. Juni 1996 ein paar kritische Bemerkungen zu Michael Peschkes Bühnenfassung von Strittmatters „Ole Bienkopp“ in der Inszenierung von Christoph Schroth am Cottbuser Theater. Genüsslich, so scheint es, fügt Koch dann noch eine Merkwürdigkeit hinzu: Als im Theater ein Originaleinspiel der Rede von Walter Ulbricht auf der 2. Parteikonferenz der SED 1952 gebracht wird, in der er den Beschluss verkündet, in der DDR den Sozialismus aufzubauen, applaudiert das Publikum. Dennoch, bei einigen aktuellen Fragen der Weltpolitik ist die Unsicherheit Kochs zu bemerken. Er will sie gar nicht kaschieren. Zu kompliziert und scheinbar völlig aus den bisherigen Erklärmustern geraten sind die Mechanismen der politischen Macht. Und der Widerstand dagegen schwächelt vor sich hin. „Was geht hier vor sich?“ Jurij Koch schließt auch diese beobachtete Merkwürdigkeit mit einer Frage und nicht mit einem Punkt ab, was nur bedeuten kann, noch ist nichts verloren. Ohne Schmerzen ist anteilnehmende Beobachtung nicht zu haben. Und so kommt Koch am 6. April 2002 von quälenden Zahnschmerzen zur Frage, wie denn die Politik Israels gegenüber den Palästinensern zu bewerten sei, ohne in den Verdacht des Antisemitismus zu geraten.
Horno hat den Kampf verloren. Jurij Koch jedoch notiert am 1. Dezember 2006: „Ich wünsche Horno, der mutigsten europäischen Widerständlergemeinschaft, an deren Seite ich mich befand und befinde, stetigen Zuwachs an Stolz, denn sie hat der Welt nützliche Skrupel und Scham beigebracht.“ Bei der Buchvorstellung am 7. Oktober 2020 im überfüllten Saal des Dorfkrugs in Neu-Horno macht diese Botschaft Mut. Nach diesem Eintrag folgen im Buch Schwarzweißfotos vom Abriss Hornos und der Umsiedlung nach Neu-Horno. Damit es dann doch nicht zum Schluss zu pathetisch wird, schließt Jurij Koch sein Tagebuch mit einem Nachtrag vom 31. Oktober 2009. Wieder einmal ist Nachwuchs in der Familie und damit Hoffnung auf Kommendes zu verkünden: „Willi ist da! […] Willi trinkt und schläft und wächst und kackt sich in die Welt …“
Jurij Koch: Gruben-Rand-Notizen. Ein Tagebuch, Domowina-Verlag, Bautzen 2020, 192 Seiten, 16,90 Euro.
Die Sorbin auf der Ravensbrück-Briefmarke
Ohne Gemütsrücksichten auf alte Herren: vor 125 Jahren wurde Marja Grólmusec geborem
Beitrag von Gerd-Rüdiger Hoffmann in der Tageszeitung "neues deutschland" am 22. April 2021
Marja Grólmusec war Sorbin, promovierte Philosophin, Katholikin, Sozialistin und Antifaschistin. In der sorbischen Lausitz, besonders in der Oberlausitz, gehört ihr Name noch heute zur Erinnerungskultur der Region. Schulen und Straßen tragen ihren Namen. In der DDR wurde sie als Antifaschistin verehrt. Auf Deutsch heißt sie Maria Grollmuß.
Ihr Gesicht ist in der DDR durch ihr Porträt auf einer der fünf Briefmarken der Ravensbrück-Serie aus dem Jahre 1959 bekannt geworden. Doch sie taugte nicht als unfehlbare Heldin und passte in kein didaktisch vereinfachtes Tafelbild des Geschichtsunterrichts.
Sie wurde am 24. April in Leipzig geboren. Ihr sorbischer Vater war Schuldirektor der ersten katholischen Bürgerschule in Leipzig. 1911 starb ihre Mutter an Lungentuberkulose. Marja und ihre jüngere Schwester Cecilija wurden von der Tante betreut. Besonders glückliche Zeiten erlebten die Schwestern in Radibor bei Bautzen, wo der Vater eine Villa bauen ließ.
Sein katholisch-bürgerliches Frauenbild sorgte für Spannungen mit seiner Tochter. Er wollte nicht, dass sie studiert, erlaubte ihr schließlich doch noch eine Lehrerinnenausbildung - wenn schon Beruf, dann einen »mütterlichen«, wie er meinte. Als Lehrerin wurde Marja nicht glücklich. Sie studierte deshalb noch Geschichte, Philosophie, Deutsch und Französisch.
In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich am Beispiel des Publizisten Joseph von Görres (1776-1848) mit demokratietheoretischen Fragen. Bereits 1925 schrieb sie »Die Frau in der jungen Demokratie«. 1926 wurde ihre Schrift »Über die weibliche Form in der Politik« veröffentlicht, in der sie die Frauen als Proletarier sieht, die sich befreien müssten.
Aufgrund ihrer Sozialisation im katholischen Milieu war sie anfangs im Umfeld der Zentrumspartei aktiv, fand in Leipzig Anschluss an den Sozialistischen Studentenbund und wurde, wie sie selbst sagte, zur Revolutionärin. Unter dem Einfluss des Austromarxismus plädierte sie für einen dritten Weg, der sozialdemokratisches Reformstreben mit der Revolutionstheorie des Marxismus-Leninismus versöhnen sollte. 1927 wurde sie Mitglied der SPD. 1929 trat sie der KPD bei, um schnell wieder ausgeschlossen zu werden, da sie die Gründung der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition ablehnte. Danach ging sie erst zur KPD-Opposition, dann zur SAP, einer linken Abspaltung der SPD, der sie sich schließlich wieder anschloss.
Ihre Kritik an der Kirche hinderte sie nicht, an ihrem tiefen Glauben festzuhalten. Ihr konstantes Thema war die »weibliche Form der Politik«, die sie in Rosa Luxemburg und Katharina von Siena verwirklicht sah. Sie hatte kein Verständnis für die Abgrenzungsrituale der linken Parteien. Dagegen müsse die Jugend kämpfen - rückhaltlos und ohne »Gemütsrücksichten auf alte Herren, denen das vielleicht nicht gefällt«. Sie setzte sich beharrlich dafür ein, »die katholische Linke mit der sozialistischen Linken zu vereinigen« und zwar »getragen von einer weit gewordenen Demokratie, die die Nationen umspannt«. Ihre »parteipolitische Odyssee« zeuge keineswegs von politischer Orientierungslosigkeit, betont Birgit Sack völlig zu Recht.
Nach 1933 unterstützte Marja Grólmusec die Familien politisch Verfolgter und gehörte dem illegalen Arbeitskreis Revolutionärer Sozialisten um Max Seydewitz an. Sie schmuggelte Informationen, Schriften und Menschen über die Grenze nach Prag, schrieb Artikel für die »Roten Blätter« und versuchte alles, um unterschiedliche Widerstandsgruppen durch gemeinsame Arbeit zu einen. Am 7. November 1934 wurde sie in Radibor von der Gestapo verhaftet und wegen Hochverrats zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Von den Mitgefangenen wurde sie als moralische und intellektuelle Instanz verehrt, die sich für Literatur und Philosophie und immer mehr für slawische Kultur und Geschichte begeisterte. Ihre Gefängnisbriefe lassen erahnen, wie viele ihrer klugen Ideen nicht mehr zur theoretischen Ausarbeitung gelangen konnten. Anschließend kam sie ins Frauen-KZ Ravensbrück. Sie litt an einer Krebserkrankung. Am 6. August 1944 starb Marja Grólmusec in Ravensbrück.
Ihr Leben und Werk sind wissenschaftlich gut erforscht. Besonders hervorzuheben sind hier die Arbeiten von Birgit Sack und Gerhard Schäfer. Sie war auch ein Thema für die Kunst, zum Beispiel im Tanzstück »Für Maria - Mitte der Nacht« des Sorbischen Nationalensembles Bautzen. Wer sich mit ihr beschäftigt, bekommt es mit einer ungewöhnlichen Intellektuellen des Widerstandes gegen die Nazis zu tun, die so weder auf den Denkmälern von früher noch im Fernsehen von heute vorkommt.
Man braucht mehr als die reine Ästhetik
Zum Tod des Schauspielers Heinz Klevenow, der in Senftenberg das Theater gerettet hat
Beitrag von Gerd-Rüdiger Hoffmann in der Tageszeitung "neues deutschland" am 9. März 2021
Der Schauspieler, Regisseur und frühere Intendant der Neuen Bühne Senftenberg, Heinz Klevenow ist tot. Er starb am 4. März im Alter von achtzig Jahren. Er wurde am 28. August 1940 als Sohn der Schauspielerin Marga Legal und des Schauspielers, Hörspiel- und Synchronsprechers Heinz Klevenow in Prag geboren. Sein erstes Engagement führte ihn nach Weimar, wo großes Theater und Provinzialität auf sehr spezifische Weise aufeinandertrafen. Es folgten Stendal, Senftenberg und Halle, dann Leitungsfunktionen in Halle (am Puppentheater), Rudolstadt und Rostock. Schließlich wurde Klevenow 1989 Intendant am Theater in Senftenberg, das zu dieser Zeit noch Theater der Bergarbeiter hieß.
Als Schauspieler hat Klevenow große Rollen gespielt, Nathan, Faust und Hamlet. Besonders beeindruckte er mit seinem herausragenden Spiel in Einpersonenstücken, - zuletzt in »Judas« von Lot Vekemans.
1989 waren jedoch noch ganz andere Qualitäten gefragt. Die Kulturbürokratie der neu anbrechenden Zeit hatte wohl keine Vorstellung davon, warum es in einer Kleinstadt weiterhin ein Theater geben sollte. »Ich war immer Realist. Das Kapital hat sich nie darum gekümmert, ob Kultur aufs Land kommt. Wer würde das Theater in Zukunft bezahlen? Es würde keine kulturpolitische Aufgabe mehr geben«, so schrieb Heinz Klevenow 2006 aus Anlass des 60. Jahrestages der Gründung des Senftenberger Theaters. Notgedrungen wurde zum Markenzeichen des Intendanten Durchsetzungsvermögen, ja eine gewisse Härte, um das Theater unter kapitalistischen Bedingungen in der Provinz am Leben zu erhalten.
Und doch waren da auch Empfindsamkeit und Mitgefühl beim Gestalten des Spannungsverhältnisses von Kunst und ästhetischer Bildung auf der einen und Marktkonformität auf der anderen Seite. Schließlich ging es auch um die Existenz von Menschen, um die Zukunft der Schauspielerinnen und Schauspielern sowie des technischen Personals. Es war eine harte Zeit, nicht ohne schmerzhafte Eingriffe. Klevenow schaffte es, sich erfolgreich mit den neuen Rahmenbedingungen herumzuschlagen, die eigenen Leute zu motivieren, die Kassenwarte und Bürokraten weitgehend ruhigzustellen und es sich nicht mit dem Publikum und vor allem mit den Feingeistern unter ihnen zu verderben.
Klevenow war ein guter Intendant, der das Weiterleben des Theaters immer wieder neu ermöglichte, auch wenn drohend von »veränderten Erwartungen«, »wachsendem Legitimationsdruck« und dem »demografischen Faktor« die Rede war. Ästhetischer Anspruch allein genügte nicht. Auch Schläue war gefragt. Und Glück gehörte auch dazu. Ein solcher Glücksfall war, dass Gardeoberst Iwan D. Soldatow 1946 im Befehlston die Idee äußerte, dass nach der Nazibarbarei in dieser Stadt ein Theater zu gründen sei. Klevenow konnte deshalb mit dem Satz kommen: Ein in Hungerzeiten gegründetes Theater schließt man nicht in Zeiten des Überflusses.
Heinz Klevenow wird als Retter des Senftenberger Theaters in die Geschichte eingehen. Ab 2004 war er nicht mehr Intendant, bestimmte jedoch in zahlreichen Rollen das Profil des Hauses weiterhin entscheidend mit. Seinen Nachfolgern, Sewan Latchinian und Manuel Soubeyrand, hatte er ein solides Fundament für eine erfolgreiche Weiterarbeit des legendären Senftenberger Theaters hinterlassen.
Hansdieter Neumann (1934-2021)
Ein Nachruf von Gerd-Rüdiger Hoffmann
Im Vorwort zum Buch von André Müller „Shakespeare ohne Geheimnis“ (Leipzig 1980) formuliert Peter Hacks eine auf den ersten Blick überraschende und auf den zweiten Blick immer noch seltsame Beschreibung, was Kommunismus sei: „Kommunismus ist die Zeit, wo Shakespeare verstanden wird.“ Ich weiß nicht, ob es Hansdieter Neumann gefallen hätte, einen Artikel über ihn, eine Laudatio und nun einen Nachruf so zu beginnen. Am 29. Januar 2021 ist er gestorben.
Als Schauspieler, so heißt es im Nachruf des Theaters „neue Bühne Senftenberg“, war er eine Ausnahmeerscheinung. Es ist kein Geheimnis, dass ich ein Verehrer seiner Schauspielkunst bin. Ob als Faust, Nathan, Diener in „Dinner for One“ oder als Pater Benedikt in „Andorra“, Hansdieter Neumann füllte alle diese Rollen in klassischer Weise ohne neumodischen Schnickschnack und doch in einmalig beeindruckender Weise aus. Außerdem, und dazu war sich der wegen seiner klassischen Rollen beliebte und vom Publikum gefeierte Schauspieler nicht zu fein, ging Neumann in Rollen auf, die er außerhalb von Theater oder Film übernahm. So sah er es zum Beispiel als Lob für seine Arbeit, wenn „Laufpublikum“ während seiner Führungen durch das Museum Knappenrode ihn kurzerhand für den echten ehemaligen Generaldirektor des Braunkohlenwerks hielten. Den Leuten etwas zu erklären, mit Witz auf kluge oder weniger kluge Meinungen zu reagieren, das machte ihm auch außerhalb des Theaters Spaß.
Doch zurück zum Satz von Peter Hacks. Der hat nämlich aus meiner Sicht so einiges mit dem Leben und der Haltung von Hansdieter Neumann zu tun. Denn in diesem Satz geht es ja nicht bloß um die utopische Vorstellung, dass eine bessere Gesellschaft nur im Einklang mit starker Poesie und damit nicht ohne Konflikte zu denken wäre. Es geht auch nicht nur darum, dass das Ideal vom Kommunismus nicht als für immer gescheitert fallengelassen werden müsste, nicht einmal darum, dass der Sozialismusversuch vor 1989 eben nicht komplett als Irrweg abgetan werden sollte. In diesem Satz ist das Widersprüchliche enthalten, womit es kritische Zeitgenossen - ob sie sich nun Marxisten, Sozialisten oder Kommunisten nennen – im jetzigen und im vergangenen Jahrhundert zu tun bekamen: Am Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen Anspruch und Möglichkeit, konnten vor allem Feingeister immer wieder neu verzweifeln. Ich glaube, auch Hansdieter Neumann kannte diese Art Unzufriedenheit, wenn die optimistische Haltung, dass die Welt und vor allem die Menschen zu bessern seien, zunehmend Blessuren bekam und innere Wut ihren Platz beanspruchte. Dennoch, und auch das glaube ich aus den kurzen Gesprächen der letzten Zeit mit ihm erfahren zu haben, kritische Haltung zum „Wie es gekommen ist“, Humor und etwas Optimismus sogar waren ihm nicht auszutreiben.
Die, fast immer zufälligen, Begegnungen mit Hansdieter Neumann werden mir fehlen.
Viele in Senftenberg und im Lande werden ihn in guter Erinnerung behalten.
„… ob es vielleicht eines Tages auch einen Sorbenstern geben werde?“
Vorstellung des Buches "Hana. Eine jüdisch-sorbische Erzählung" von Jurij Koch
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg e.V. hatte für den 27. Januar 2021 eine Veranstaltung zum neuen Buch „Hana. Eine jüdisch-sorbische Erzählung“ von JURIJ KOCH mit einem Nachwort des Gründungsdirektors des Centrum Judaicum Berlin HERMANN SIMON geplant.
Corona-bedingt mussten wir auch die Planungen zu dieser Veranstaltung erst einmal aussetzen.
Jurij Koch war Mitte zwanzig als seine Novelle „Židowka Hana“ („Die Jüdin Hana“) 1963 auf Sorbisch erschien. Unter den Sorben ist das Buch bekannt und beliebt und erfuhr mehrere Auflagen. Zumindest Auszüge wurden vor 1989 im Sorbischunterricht gelesen und diskutiert. Lenka Cmuntova, Regisseurin aus Prag, inszenierte 1968 mit dem Sorbischen Pioniertheater Bautzen eine dramatisierte Fassung der Novelle.
Als der Historiker und Gründungsdirektor der Stiftung Neue Synagoge Berlin Centrum Judaicum Hermann Simon 1990 Jurij Koch um eine deutsche Übersetzung der Novelle bat, war er von der Idee gar nicht begeistert. Bis heute sieht Koch seine Novelle kritisch. Es wäre ein erster literarischer Versuch gewesen, sentimental, voller ausschweifender Naturbetrachtungen und stellenweise regelrecht pathetisch. Einer Übersetzung würde er niemals zustimmen. Das war es dann erst einmal – bis der linke Landtagsabgeordnete Heiko Kosel Hermann Simon bat, auf einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Geburtstages der am 15. August 1918 in Horka geborenen katholischen Sorbin jüdischer Herkunft Annemarie Schierz zu sprechen. Das war es dann erst einmal – bis der linke Landtagsabgeordnete Heiko Kosel Hermann Simon bat, auf einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Geburtstages der am 15. August 1918 in Horka geborenen katholischen Sorbin jüdischer Herkunft Annemarie Schierz zu sprechen.
Historiker werfen Schriftstücke nicht weg, und so fand Hermann Simon den Briefwechsel mit Koch über die literarische Figur Hana und die historisch verbürgte Person Annemarie Schierz bzw. Kreidl, die im Dorf nur Hana Šĕrcec oder Kschischans Hana genannt wurde. Simon sichtete das Material und sagte zu. Jurij Koch, 1936 in Horka geboren, ließ das Thema ebenfalls nicht los. Sein 2012 erschienenes Buch „Das Feuer im Spiegel - Erinnerungen an eine Kindheit“ beginnt mit einer Begebenheit, in der es genau um diese Frau geht. Diese Erinnerungen sind für Hermann Simon wichtige Anregung, die Biografie der tatsächlichen Hana doch noch erforschen zu können. Jurij Koch entschloss sich schließlich, die fiktionale Geschichte über Hana in deutscher Sprache neu zu schreiben. Man ahnt das Risiko, einmal Veröffentlichtes neu zu schreiben, also umzuschreiben. Vielleicht reicht das Ergebnis nicht ganz, um wie Kochs „Augenoperation“, „Der Kirschbaum“ oder „Jubel und Schmerz der Mandelkrähe“ zum Besten der Gegenwartserzählkunst in deutscher Sprache gerechnet zu werden. Ein herausragendes Stück Literatur ist es allemal und ein Glücksfall, dass diese Erzählung mit diesem Stoff nun vorliegt. Ein weiterer Glücksfall ist das Nachwort von Hermann Simon, in dem er akribisch, mit 87 Anmerkungen belegt, den Forschungsstand zur Biografie von Annemarie Schierz einer wahren Kriminalgeschichte gleich ausbreitet.
Die Erzählung behandelt vier Jahre. Die Handlung beginnt im Frühling 1939 und endet im Sommer 1943. Ort der Handlung ist Horka, das sorbische Hórki bei Kamenz, heute Ortsteil von Crostwitz (Chrósćicy), nicht das Horka (Hórka) bei Niesky, das während der Nazizeit Wehrkirch heißen musste. Allein der Titel des Buches - „Eine jüdisch-sorbische Erzählung“ - lässt bereits vermuten, dass es hier nur um wenige Jahre gehen kann. Das Unheilvolle wird von Jurij Koch ohne Umwege, ohne künstlichen Spannungsaufbau gleich auf den ersten Seiten eingeführt. Wie sollte auch eine Geschichte über eine jüdisch-sorbische junge Frau in dieser Zeit anders begonnen werden. Dass sie nicht gut ausgehen wird, dürfte von Anfang an klar sein. Dennoch ist Spannung garantiert. Der nur achtundsiebzig Seiten umfassende Text, einmal zu lesen begonnen, lässt nicht los. Es geht um einen Mord, um Nazis als Außenseiter der Dorfgemeinschaft, um unspektakulären Widerstand, um Anpassung, um Liebe in schwerer Zeit, um Solidarität als das Normale in dem kleinen sorbischen Dorf, auch um Angst und Verrat. Die Erzählung handelt von der anfangs zwanzigjährigen Hana, die das Sorbische und Katholische mit Selbstverständlichkeit auf dem Hof ihrer Stiefeltern lebt, eigentlich aber Tochter wohlhabender Juden aus Dresden ist. Jüdische Schicksale aus der Zeit der systematischen Verfolgung und Vernichtung durch den deutschen Faschismus sind wahrlich nicht selten Thema in der Literatur. Die Perspektive jedoch, aus der Jurij Koch erzählt, dürfte etwas Einmaliges sein. Das Schlimme, das Gemeine, kommt leise ins Dorf Horka, in die Welt der Sorben und damit in das Leben von Hana. Nicht Hana ist die Fremde im Dorf, auch nicht als immer mehr darüber zu reden ist, dass sie jüdische Eltern habe. Das Fremde im Dorf ist der Wahnsinn der „modernen Zeitläufe“, der die Menschen wohl als Gottes Ebenbilde, „aber doch unterschiedlich in Güte und Gattung“ (S. 24), wie der Crostwitzer Pfarrer predigt, zu sehen verlangt. Fremd sind Soldaten mit „ihren aufgenähten flügelspreizenden Adlern über den rechten Brusttaschen und den mitfliegenden hakigen Kreuzen im Schwanzschlepp“ (S. 10). Fremdkörper im Dorf ist der Polizist, des Sorbischen nicht mächtig, der aber unter den Sorben „für deutsche Ordnung zu sorgen hatte“ (S. 21). Und Hanas jüdische Eltern in Dresden? „Sie sind mir fremd. Ich lebe hier mit meinen Eltern. Sie sind meine richtigen Eltern. Obwohl sie nicht meine richtigen Eltern sind. (…) Hier bin ich aufgewachsen. Hier ist mein Zuhause. Meine Dresdener Eltern haben große Sorgen. Es ist besser, wenn sie sich nicht auch noch um mich sorgen müssen. Und ich nicht um sie.“ (S. 15f.)
Wie so oft bei Jurij Koch, eine sehr eigenwillige Poesie der leisen Töne und des Einklangs von Natur und Mensch kennzeichnen seine Erzählkunst auch in diesem Buch. Die „ewige Wiederkehr des Gleichen“ in der Natur, im Rhythmus der Arbeiten auf dem Feld und im Stall und im nahen Steinbruch gehört zum Alltag und bedarf keiner philosophischen Reflexion. Wie auch die sorbischen Feste, die Trachten und die Umgangsformen, das Sorbische im Katholischen und das Katholische im Sorbischen einfach da sind und ohne draufgesetzte Erklärung auskommen. Der Tagesablauf ist einem Naturgesetz ähnlich geregelt und immer gleich, auch für Hana: „Eine Stunde noch, dachte sie, dann ist der Sonntag wieder vorbei. Füttern, melken, zu Abend essen, ins Bett! So geht’s Tag für Tag. Alle Tage, alle Feiertage.“ (S. 8) Die Welt da draußen mit ihrem Streben nach Fortschritt und seltsamen neuen Wertvorstellungen darüber, wer die Minderwertigen und wer die Höherwertigen seien, sie möge wenig mit diesem im Gleichklang von Natur und Mensch ablaufendem Leben im Dorf und der harten Arbeit im nahen Steinbruch zu tun haben. Neue Moden und Anweisungen, das Tragen eines Judensterns etwa, passen nicht ins sorbische Dorf. „Und ob sich Hana auch einen Stern annähen müsse? ‚Quatsch!‘, sagte der Schmied. ‚Geht gar nicht. Passt nicht zur Tracht.‘“ Anfangs machen die Dörfler noch Witze und halten zusammen als der Polizist Hana den Besuch von Tanzveranstaltung und Gottesdienst verbietet. Noch trugen „die Ereignisse der Alltage im Dorf“ dazu bei, die Welt zu verklären. Doch der Krieg wird mit dem Eintreffen schwarz gerahmter Briefe gegenwärtiger. Das Misstrauen untereinander wächst und die Sorge auch, „dass das katholisch-slawische Getue nicht mehr in die modernen Zeitläufe passe.“ (S. 52) „… ob es vielleicht eines Tages auch einen Sorbenstern geben werde?“ (S. 47) Die Flucht in die Schweiz, bis ins Kleinste von Hanas Liebsten Bosćij gut geplant, scheitert. Bosćij wird verhaftet, weil er der Einberufung zur Wehrmacht nicht nachkam. Ihr Stiefvater überlebt die psychischen Schikanen nicht. Gestapo und Dorfpolizist wissen, wie sie den treuen Katholiken am besten erledigen können. Sie streuen das Gerücht, dass er ein Verhältnis in Schande mit seiner jüdischen Stieftochter hätte. Hana wird deportiert. Niemand weiß, wann und wo sie umgebracht wurde. So endet die Erzählung. Und so schließt auch der Bericht von Hermann Simon über das Leben der Annemarie Schierz. Auf den letzten Seiten, Hana berichtet mitgefangenen Frauen aus ihrem Leben, entfaltet sich noch einmal in besonderer Weise der einmalige Stil des meisterhaften Erzählers Jurij Koch – berührend und doch ohne Sentimentalität. Dem Buch ist eine weite Verbreitung zu wünschen.
Auf dem Stolperstein in der Crostwitzer Straße 17 in Horka ist zu lesen:
„Tule Narodźi so a bydleše / Annemarie Kreidl / přiwzata / Hana Šěrcec / katolska serbowka / židowskeho pochada / lětnik 1918 / zajata 1942 / morjena 1943“
„Hier wurde geboren und lebte Annemarie Kreidl, adoptierte Hana Šĕrcec, katholische Sorbin jüdischer Herkunft, Jahrgang 1918, verhaftet 1942, ermordet 1943“
[Fotos: Gerd-Rüdiger Hoffmann]
Strukturwandel in der Lausitz: Was bedeutet das für die politische Bildungsarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg e.V.?
Diskussionsbeitrag auf der Mitgliederversammlung der RLS Brandenburg
Gerd-Rüdiger Hoffmann
(Überarbeitete Fassung des auf der Mitgliederversammlung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg e.V. in Potsdam am 11. Mai 2019 gehaltenen Vortrages)
Einführung: Denkbares und Machbares
In diesem Beitrag kann nicht der gegenwärtige Stand der politischen Aktivitäten und schon gar nicht die Diskussion zum als Strukturwandel bezeichneten Prozess umfänglich dargestellt werden. Wer sich in heute üblicher Weise mit den Stichworten „Strukturwandel Lausitz Projekte“ informieren möchte, hat nach 0,26 Sekunden bei der wohl mächtigsten Meinungslenkungsmaschine über 122.000 Fundstellen zur Auswahl. Immerhin sind darunter 8.400 Treffer, die auch Aktivitäten der Rosa-Luxemburg-Stiftung enthalten. Aber Unübersichtlichkeit und Unvollständigkeit bleiben. Klarheit, worum es eigentlich geht, ist in 0,26 Sekunden nicht zu erreichen.
Deutlich wird jedoch, dass es sehr viele Studien gibt, dass Regierungen und Parteien, Wirtschaftsinstitute, Lobbyverbände der Wirtschaft, Umweltinitiativen und Medien unterschiedliche Meinungen verkünden, andererseits auch gemeinsame Positionen politischer Konkurrenten zur Schau gestellt werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke betonte zum Beispiel kurz vor dem gemeinsamen Besuch der Ministerpräsidenten der drei ostdeutschen „Kohleländer“ in Brüssel am vergangenen Montag: „Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Nicht mal ein Parteibuch.“ Auch Repräsentanten der brandenburgischen linken Landtagsfraktion erklärten, dass sie sich für die Umsetzung des im Konsens erarbeiteten Maßnahmenkatalogs der „Kohlekommission“ einsetzen werden. Übersehen wird oft, dass Hannelore Wodtke aus Welzow, Mitglied der Kommission, dagegen stimmte und ihren Schritt auch nachvollziehbar begründete. Aber immerhin steht jetzt im Landtagswahlprogramm, dass die LINKE sich für den Erhalt von Proschim/Prožym einsetzen werde. Auch die CDU Brandenburg verlangt inzwischen eine klare Entscheidung gegen die Abbaggerung von Proschim/Prožym. Die SPD läuft also Gefahr, neben der AfD die einzige Partei zu sein, die den Tagebau Welzow-Süd II weiterführen und damit das sorbische Dorf opfern will.
Deutlich wird weiterhin der Gegensatz zwischen den in Wissenschaft und interdisziplinären Studien erarbeiteten Erkenntnissen einerseits und den tatsächlichen oder vermeintlichen Möglichkeiten politischer Verantwortungsträger auf der anderen Seite. Doch dieser Konflikt wird politisch kaum thematisiert, sogar Lügen wird nicht immer öffentlich widersprochen. Der Ministerpräsident Brandenburgs warnt zum Beispiel davor, sich klar zum Erhalt von Proschim/Prožym zu bekennen, weil sich dann Entschädigungsansprüche des Konzerns LEAG ableiten ließen. Das ist jedoch falsch. Die Regierung aus SPD und Linken hat zwar 2014 einen Braunkohleplan beschlossen, der die Abbaggerung von Proschim/Prožym vorsieht. Die LEAG hat allerdings bis heute keinen bergrechtlichen Genehmigungsantrag gestellt, so dass Entschädigungsansprüche gar nicht möglich sind. Aussagen im Wahlprogramm und von linken Abgeordneten sind die eine Seite, das einheitliche Handeln der rot-roten Regierung scheint davon nicht berührt zu sein. Und so entsteht der Eindruck, dass Linke in Regierungsverantwortung nicht erst am Ende einer Debatte über Kompromisse reden, sondern bereits zu Beginn des notwendigen Streitens über die Frage „Was kommt nach der Kohle?“ mit dem Koalitionspartner, der Gewerkschaft, Wirtschaftsverbänden oder Kommunalvertretern den Kompromiss als Ausgangspunkt ins Spiel bringen. Vielleicht werden deshalb Studien der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema Kohleausstieg und Strukturwandel, die über das gerade jetzt mal Machbare bzw. Gewollte hinausgehen, nicht selten als Störung empfunden. Auch die institutionalisierte regierende Linke hat es versäumt, zivilgesellschaftliche Initiativen, alternative Ideen in der eigenen Partei sowie die Wünsche der durch drohende Abbaggerung Betroffenen angemessen zu würdigen und in politisches linkes Handeln umzusetzen. Bis auf wenige Ausnahmen war auch nicht die Bereitschaft zu erkennen, in Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung mitzudiskutieren, obwohl diese Veranstaltungen durchaus auf Interesse bei der Bevölkerung im betroffenen Revier stoßen. Zum Beispiel kamen am Reformationstag in dem kleinen Dorf Proschim/Prožym über einhundert Personen zu einer Diskussionsrunde über Strukturwandel in der Lausitz. Wirkungslos ist das wohl doch nicht. Die linke Landtagsfraktion bekannte sich als Ergebnis ihrer Klausur im Februar 2019 dazu, eine schnelle und klare Entscheidung gegen die Abbaggerung von Proschim/Prožym zu fordern. Das ist gut so. Hier steht DIE LINKE im Widerstreit zur brandenburgischen SPD und ihrem Ministerpräsidenten. Dieser Gegensatz muss jedoch konzeptionell weiter ausgearbeitet werden, wenn es nicht bloß um Schlagabtausch oder Kompromiss gehen soll, sondern um fundierte programmatische Konzepte mit einem gesamtgesellschaftlichen Anspruch.
Schlagworte und Wesen des Strukturwandels in der Lausitz
Betrachten wir die Schlagworte der aufgeregten Diskussion zum Strukturwandel in der Lausitz, so tauchen vor allem drei Motive bzw. Probleme in den von den Medien befeuerten Kontroversen auf:
Erstens, Strukturwandel wird weitgehend auf Kohleausstieg und die damit verbundene Sorge um den Verlust von gut bezahlten Industriearbeitsplätzen reduziert,
zweitens, die mögliche Unzufriedenheit der Berg- und Energiearbeiter und ihrer Gewerkschaft, die besonders in einem Jahr mit Landtagswahlen zur Gefahr für die SPD werden könnte,
drittens, die Angst der demokratischen Parteien vor dem Erstarken der politischen Rechten in Gestalt der AfD.
Doch worum geht es darüber hinaus, wenn von Strukturwandel die Rede ist? Daniel Häfner, der in Cottbus ehrenamtlich für das Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung verantwortlich ist, hat in einer Kurzstudie über die Transformation der Lausitz „nach der Kohle“ mehrere Aspekte kritisch beleuchtet, die diese Debatte kennzeichnen. Drei Aspekte will ich hervorheben und kurz auf der Grundlage meiner Erfahrungen nach mehreren Veranstaltungen kommentieren.
Erstens geht es um die Überbetonung der Braunkohlewirtschaft für die Region.
Nehmen wir die Diskussion über die Arbeitsplätze. Wenn behauptet wird, dass nach dem „Ende der Kohle“ 8.000 direkte Arbeitsplätze verloren gingen, dann ist das naiv, Unkenntnis oder Lüge. Selbst das Bergbauunternehmen LEAG sagt, dass es neue Geschäftsmodelle für die Zeit „nach der Kohle“ vorbereite und dafür doch weiterhin einen erheblichen Teil der Mitarbeiter benötige. Bei der Zahl 8.000 sind übrigens die Angestellten des Bergbausanierers LMBV mitgerechnet, die überhaupt nicht gefährdet sind – im Gegenteil. Weiterhin ist festzustellen, dass der größte Teil der LEAG-Beschäftigten in den nächsten 10 bis 20 Jahren ohnehin in Rente geht. Schwerer wiegt, dass die Folgearbeitsplätze der Braunkohlenwirtschaft ebenfalls betroffen sind. Wir haben allerdings schon heute das Problem, dass es hier ein Lohngefälle im Vergleich zu den LEAG-Mitarbeitern gibt. Die IG-Metall weist darauf zu Recht immer wieder hin. Betrachten wir die Bruttowertschöpfung der Kohle- und Energiewirtschaft im Revier zeigt sich ebenfalls ein anderes Bild als von SPD, „Lausitzer Rundschau“, IGBCE oder „Pro Lausitzer Braunkohle“ propagiert. In meinem Landkreis, also im ehemaligen Zentrum der Braunkohleindustrie rund um Senftenberg, liegt der Anteil an der Bruttowertschöpfung heute bei etwa 5,6 Prozent. Im Nachbarkreis Spree-Neiße ist es allerdings etwa das Achtfache. Das wurde erst kürzlich auf einer von Axel Troost initiierten Veranstaltung in Weisswasser bekanntgegeben, der übrigens im Auftrag der Luxemburgstiftung an einer Studie zum Thema Strukturwandel in der Lausitz arbeitet.
Das eigentliche Problem, nämlich der Fachkräftemangel im Revier, wird weitgehend ausgeblendet, damit auch die Frage, ob nicht bei den LEAG-Mitarbeitern das Potential für zukünftige Arbeitsplätze im Zuge des Strukturwandels liegen könnte. Ein Blick auf die Ausbildungsangebote des Bergbauunternehmens lässt vermuten, dass diese Frage durchaus positiv beantwortet werden kann. Allerdings, wenn es Fälle gibt, wo ein Lehrling bei der LEAG mehr Geld verdient als eine Staatlich geprüfte Heilerziehungspflegerin, und ein Kindergartenerzieher nicht einmal die Hälfte des Lohnes eines Facharbeiters im Bergbau bekommt, dann ergeben sich Regulierungsaufgaben für die Politik in Bund und Land. Es kann natürlich nicht darum gehen, bei der LEAG die Löhne zu senken, andersrum wird es etwas mit einem erfolgreichen Strukturwandel in der Lausitz wie im ganzen Land.
Zweitens hebt Daniel Häfner den Aspekt hervor, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen über konkrete Maßnahmen gäbe, die eingeleitet werden sollten.
Noch im Oktober 2018 lautete eine Schlagzeile „Woidke und Kretschmer kämpfen um die Kohle“. Einen Tag vor der Konstituierung der „Kohlekommission“, die ja eigentlich „Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ heißt, also Ende Juni 2018, hieß es in einer Pressemitteilung der brandenburgischen Staatskanzlei „Erst Strukturentwicklung, dann Kohleausstieg“. Die Politik dürfe nicht nur an den Klimaschutz, sondern müsse auch an die Menschen und ihre Perspektiven denken, so Woidke in rbb24 im Oktober 2018. Ein Kohleausstieg vor 2040, so Woidke, würde der politischen Rechten in die Hände spielen.
Der Ton ist inzwischen moderater geworden, aber die seltsame Unlogik, in der Klimaschutz, Strukturwandel und die Menschen in der Lausitz als Gegensätze erscheinen, ist geblieben. Und seitdem die Ergebnisse der Arbeit der „Kohlekommission“ vorliegen, vor allem der vorgeschlagene Maßnahmenkatalog, ist das Rennen auf die zu erwartenden Fördermittel eröffnet. Proaktivem Handeln in einem demokratisch und rational planbaren Strukturwandelprozess wird dieses Sammelsurium von in eine Konsenssoße gekippten Ideen kaum dienlich sein.
Für Südbrandenburg sind insgesamt 67 Maßnahmen genannt, 22 als Sofortmaßnahmen vorgeschlagen. So stehen dort nebeneinander zum Beispiel die „Ansiedlung einer ggf. auch länderübergreifenden, europäischen Zellenproduktion für die nächste Batteriegeneration“, der „Neubau einer BMX-/Trampolinhalle“ in Cottbus, auch ein Aussichtsturm in der Lieberoser Heide ist Bestandteil eines Projektes, „Projekte Bereich Sorben/Wenden“, „Schiffbare Seenverbindungen“, „Industriestandorte im Lausitzer Seenland – Weiterentwicklung“, „Kulturplan Lausitz“ usw. usw.
Dann kommt noch dazu, dass Behörden und ein ganzes Ministerium in die Lausitz verlegt werden sollen. Die Regierungen der drei ostdeutschen „Braunkohleländer“ sind sich hier einig. Jedenfalls sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nach einem Gespräch der Ministerpräsidenten: „Wir sprechen dabei sowohl über Verwaltungsstellen als auch die Bundeswehr. Ein oder zwei Bataillone wären die wirtschaftliche Lösung für eine Stadt wie Weißwasser oder Spremberg.“ Er sprach sich auch für die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen durch den Bund aus. Im Fall des Kohleausstiegs fordert er jährlich 1,5 Milliarden Euro Hilfen für einen Zeitraum von 40 Jahren (vgl.: dpa 25.1.2019).
Ich sage, das kann nicht gut gehen. Der Ruf nach entschlossenem und schnellem Handeln wird die Exekutive stärken, Parlamente und kommunale Gremien dagegen wegen ihrer Langsamkeit diskreditieren. Der Wettbewerb unterschiedlicher Interessen um Fördermittel unter der Überschrift Strukturwandel könnte der Demokratie insgesamt schaden, weil lokale Partikularinteressen sich immer noch am besten von rechten Demagogen instrumentalisieren lassen und weil die garantiert lauter werdende Rede von den Sachzwängen und den „nur gemeinsam zu bewältigenden Herausforderungen“ den Mut zur Alternative noch mehr lähmen werden. Außerdem ist ein Programm zum Strukturwandel, das nicht das gesamte Land Brandenburg, also auch die Uckermark und die Prignitz, sowie internationale Aspekte im Blick hat, wahrscheinlich von vornherein als provinzielles Unterfangen zum Scheitern verurteilt.
Drittens geht es um Kontroversen über den Sinn eines Strukturwandels, um Emotionen und Wertvorstellungen.
Daniel Häfner nennt das „unterschiedliche Narrative zu Strukturwandel und Transformation, die aber öffentlich kaum diskutiert werden“. Eine der wichtigsten Konfliktlinien zeichnet sich m.E. ab, wenn über Wirtschaftswachstum, Industriearbeitsplätze in gleicher Anzahl wie früher in der Kohle und Sonderwirtschaftszone Lausitz gesprochen wird. Hier sind nach meiner Auffassung marxistische Analyse und linke Politik gefragt. Die alternative Wirtschaftszeitung „OXI“ ist in diesem Zusammenhang erhellend. Denn es liegt auch in unserer Verantwortung als linke Bildungsinstitution mit theoretischem Anspruch die aktuelle Situation und die Aufgaben bei der Bewältigung von Umbrüchen in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen, also das gegenwärtige Wirtschaftssystem infrage zu stellen, nicht am Ersatz für wirtschaftliche Auslaufmodelle in der gleichen Logik wie bisher zu arbeiten, was jedoch einen „sozialistischen Kompromiss“ (Tom Strohschneider) nicht ausschließen muss.
Drei Konfliktlinien in der Debatte um Strukturwandel und Transformation
Dazu einige wenige Bemerkungen zu den drei genannten Konfliktlinien:
Erstens: Zum allgemein in Bildung und Politik anerkannten wirtschaftspolitischen Ziel der gegenwärtigen kapitalistischen Marktwirtschaft gehört neben der Preisstabilität, hoher Beschäftigungsquote, dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei Export und Import vor allem stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Dafür gibt es sogar mit dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz vom 8. Juni 1967 eine gesetzliche Grundlage. Wenn auch zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung auf ihrer Webseite auf die heute notwendige erweiterte Interpretation, nämlich unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Ökologie, hinweist, so wird weitgehend noch immer von einem kausalen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsquote ausgegangen. Parteien von SPD bis FDP und Gewerkschaften halten an dieser Wachstumsgläubigkeit fest. Als Kurt Biedenkopf 1986 in einem Spiegel-Interview diesen direkten Zusammenhang bezweifelte und diese Ansicht in seinen Vorlesungen Ende der 1980er Jahre an der Karl-Marx-Universität bekräftigte, galt er als Häretiker. Auch heute noch werden Nachhaltigkeit und Ökologie als etwas der eigentlichen Wirtschaftspolitik Nachgeordnetes behandelt. Diese Haltung entspringt einem Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnis, das noch immer auf Naturbeherrschung aus ist, wenn auch viel stärker als im 19. und 20. Jahrhundert auf der Grundlage eines hochgradig arbeitsteilig organisierten Prozesses. Technische Lösungen im Bunde mit einer „Verrechtlichung“ wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die eigentlich politisch auszufechten wären, ermöglichen eine Sozialtechnologie, welche die „Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts“ (Max Horkheimer) weitgehend ausblendet. Bereits Marx hat Grundlagen einer Kritik an dieser Denkweise gelegt. Exemplarisch u.a. nachzulesen in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 sowie im relativ kurzen Landwirtschaftskapitel des 1. Bandes des Kapital. Dort heißt es, die Tragik des Kapitalismus mit seiner nicht zu bremsenden Dynamik in der Produktion bestünde darin, „indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter“. Ein Indiz für eine Vernachlässigung dieses kritischen Ansatzes in aktuellen linken programmatischen Dokumenten ist m.E., wenn das „Kulturkapitel“ als Anhang zum Eigentlichen erscheint, wenn eine organische Verknüpfung von Wirtschaft, Kultur und Anthropologie nicht gelingt. Die daraus auf Wachstum gegründete Rationalität konnte dazu beitragen, zum Beispiel die geplante Vernichtung des sorbischen Dorfes Proschim/Prožym aus wirtschaftlichen und rechtlichen Sachzwängen heraus über lange Zeit stillschweigend zu akzeptieren.
Zweitens: Die Vorstellung, dass nach dem Wegfall der Arbeitsplätze „in der Kohle“ der absolute Schwerpunkt beim Strukturwandel darauf liegen müsse, in gleicher Zahl Industriearbeitsplätze in anderen Wirtschaftszweigen zu schaffen, ist ohne Grundkenntnisse in kritischer Theorie schwer zu widerlegen. Mehr noch, besonders in Zeiten angespannter Wahlkämpfe dürfte eine Kritik an dieser Forderung, außer bei einigen Anhängern der Grünen und der Linkspartei, kaum Beifall finden. Denn erst einmal ist nichts dagegen zu sagen, dass beim Wegfall von Arbeitsplätzen in einer Region daran gearbeitet werden muss, Rahmenbedingungen für neue zu schaffen, möglichst auf gleichem Lohnniveau für die Beschäftigten wie vorher. Am konsequentesten drückt das die zur „Lausitzformel“ avancierte Aussage „ein Gigawatt für ein Gigawatt“ der Industrie- und Handelskammer Cottbus aus. Bedeuten soll das, für jedes Gigawatt Kraftwerksleistung, das wegen bundespolitischer Entscheidungen in der Lausitz abgeschaltet wird, muss rechtlich verbindlich eine industrielle Aufbauleistung im gleichen Wert in der Region erfolgen. In der Praxis würde das jedoch vor allem bedeuten, Tür und Tor zu öffnen, um große Konzerne überproportional zu fördern. Der brandenburgische Ministerpräsident bewegt sich auf dieser Linie und fordert deshalb im Namen seiner Landesregierung sowie der von Sachsen und Sachsen-Anhalt, dass die Europäische Union die bisher bei 10 Prozent festgelegte Höchstförderung für große Unternehmen im Rahmen des Regionalbeihilferechts anhebe, weil Konzerne sonst keine echten Anreize für die Ansiedlung von Industriearbeitsplätzen erkennen könnten. Damit werden dezentrale Ansätze und Alternativen zum bisherigen Wirtschaftsmodell kaum eine Option, an der zu arbeiten sich lohnte.
Drittens: Als effektive, ja unbürokratische, Lösung für viele Probleme beim Strukturwandel gilt die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone Lausitz. Besonders hier ist nach meiner Auffassung Kritik aus linker Perspektive gefragt. Das Problem ist, dass der Ruf nach Abbau bürokratischer und rechtlicher Hürden in der Ansiedlungspolitik aus teilweise guten Gründen recht publikumswirksam daherkommen können. Dass es dann auch um späterhin schwer zu korrigierende Ausnahmetatbestände in verschiedenen Rechtsbereichen gehen kann, wird unter dem Druck, schnell und effektiv handeln zu wollen, kaum beachtet bzw. bewusst ignoriert. Eine Sonderwirtschaftszone, in der durch die freie Entfaltung der Selbstregulierungskräfte des Marktes der Strukturwandel vorangetrieben werden soll, übersieht wesentliche Momente. In 15 Thesen für einen Strukturwandelprozess in der Lausitz von Kathrin Kagelmann, Antonia Mertsching und Mirko Schultze von der linken Landtagsfraktion in Sachsen heißt es dazu:
„Unabhängig von übergeordneten rechtlichen Hürden laden solche Sonderzonen immer zuerst Unternehmen mit kurzfristigen Renditeerwartungen bzw. kritischen Produktionszielen und/oder -bedingungen ein, die gerade nicht an einer regionalen sozial-ökologischen Wirtschaftsentwicklung interessiert sind. Dagegen haben Vorgaben beispielsweise im Denkmal- oder Umweltschutz die Lausitz zu einer kulturhistorisch und naturtouristisch wertvollen Region wachsen lassen, die gerade jetzt nicht ihre Vorteile preisgeben darf, wo sie individuell sichtbar und regionalwirtschaftlich spürbar werden. Im Gegenteil: Erst starke umweltpolitische Regulierungen veranlassen Unternehmen zu Innovationen, Qualitätsverbesserungen und Effizienzsteigerungen und verschaffen ihnen so Wettbewerbsvorteile. Der Abbau von Bürokratie und die Beschleunigung von internen Verwaltungsverfahren stellen eine politische aber auch staatliche Herausforderung dar. Insofern eröffnen Experimentierklauseln insbesondere im Verwaltungsrecht Chancen, angepasste Einzellösungen rascher durch kommunal erweiterte Entscheidungskompetenzen auszuprobieren. Wir brauchen eine kritische Reflektion von Verwaltungsabläufen und lebensnahe Entscheidungen – angefangen beim Bauantrag bis hin zum Werbeaufsteller. Allgemein aber gilt: Strukturwandel kann und darf übergeordnetes Recht nicht beugen. Gerade Sozial-, Umwelt- oder Beteiligungsstandards sind regional nicht verhandelbar!“
Dem ist zuzustimmen. Und selbst dann, wenn diese Thesen für einige „zu wenig konkret“ sein sollten, eine gute Grundlage für einen Perspektivenwechsel im Herangehen an die Fragen des Strukturwandels „nach der Kohle“ bieten sie allemal. Diesem Ansatz folgen im Großen und Ganzen auch die Diskussionsrunden, die auf Initiative des Ortsvorsitzenden der LINKEN in Senftenberg Eckhart Stein mit Vertreterinnen und Vertretern der Lausitzer Parteibasis aus Brandenburg und Sachsen regelmäßig stattfinden.
Die Wirkung von zwei scheinbar unvereinbaren Narrativen in der Lausitz
Es geht aber auch um längerfristig gültige emotionale Grundströmungen. Im Revier um Senftenberg, wo der aktive Bergbau bereits 1999 endgültig beendet wurde, wirkt zum Beispiel die alte Losung „Ich bin Bergmann, wer ist mehr“ noch immer, und nicht bloß bei ehemaligen Bergleuten. Wer dieses Narrativ nicht beachtet (nicht bloß in der Wahlpropaganda, sondern im Grundverständnis dieser Region), hat es schwer. Das nahezu inflationär gebrauchte Wort von der Missachtung der Lebensleistung der Arbeiter im Osten erfährt hier eine besondere Sprengkraft, wenn sich diese Berufsgruppe subjektiv als Auslaufmodell abgewertet an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlt. Eine Studie unter Leitung von Prof. Klaus Dörre von der Universität Jena in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die noch in Arbeit ist, trägt den Titel „Gesellschaftsbilder, Arbeits- und Lebensbedingungen von Beschäftigten im Braunkohlebergbau der Lausitz“. Wir werden die Ergebnisse in der brandenburgischen Lausitz öffentlich präsentieren. Dann wird sich zeigen, ob dieses Narrativ produktiv zur Geltung gebracht werden kann oder doch bloß den notwendigen Transformationsprozess behindert.
Ein anderes Narrativ, nämlich das Bekenntnis zur sorbischen/wendischen Kultur, entfaltet bereits im Zusammenhang mit dem Thema Strukturwandel in der Lausitz eine erstaunlich produktive in die Zukunft weisende Wirkung. Hier haben sicherlich auch Aktivitäten der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu diesem positiven Trend beigetragen. Auch der entsprechende Abschnitt im Landtagswahlprogramm der Linkspartei ist nach meiner Auffassung einer der stärksten, weil auf der Grundlage langjähriger konzeptioneller Arbeit entstanden und deshalb weitgehend frei von taktisch tagesaktuellen Überlegungen formuliert.
Nebenbei: Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass kontinuierliche inhaltliche Arbeit an einem Thema und Streit zum Zwecke gemeinsamen Handelns sich auszahlt, vielleicht sogar wirkungsvoller selbst in Wahlkämpfen ist als das ständige hektische Arbeiten an „bunten Plakaten“, an der Verbesserung des „Botschaftsmanagements“ und der „Performance“.
Einige Schlussfolgerungen für die politische Bildungsarbeit
Es geht also um das Stellen der richtigen Fragen, oft um Perspektivenwechsel und um konzeptionelle Probleme des Herangehens als Grundlage für die Erarbeitung der richtigen Strategie.
Genau hier sind die Aufgaben der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu verorten.
- Studien über die Transformation der Lausitz „nach der Kohle“ sind weiterhin wichtig, wobei Handreichungen für in der Partei sowie in kommunalen Gremien oder in Initiativen engagierte Linke durchaus einen höheren Stellenwert bekommen sollten.
- Weiterhin geht es, vor allem auf Landesebene, um politische Bildung, Aufklärung und – ja – auch um Politikberatung. Hier hat, das muss gesagt werden, die Rosa-Luxemburg-Stiftung bisher weitgehend versagt. Denn konzeptionelle Arbeit der parteinahen Stiftung und parlamentarische Aktivitäten der Fraktion stehen bisher noch zu oft nebeneinander, sind kaum organisch miteinander verbunden.
- Es geht um Inhalte, die erst erarbeitet werden müssen, um Methoden des Herangehens an neue Fragen und nicht um alleinige Bestätigung des eingeschlagenen Kurses. Das ist schwierig, aber nur so können Theorie und linke Politik in der Tradition von Marx und Luxemburg, Bloch und Gramsci in ein produktives Spannungsverhältnis gesetzt werden, wo es kritisch und solidarisch zugleich zugeht.
Man kann auch sagen, wir haben am „utopischen Lächeln“ zu arbeiten, an der konkreten Utopie, auch wenn die Chancen auf Erfolg im Falle „Strukturwandel in der Lausitz“ gar nicht gut sind.
Zum Beitrag als PDF-Datei ... (mit Quellen, Literatur und Hinweisen)
Entnennung und Entpolitisierung. Isabella Greif und Fiona Schmidt über den staatsanwaltschaftlichen Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt
Beitrag in der Zeitung "neues deutschland" (S. 14)
von Gerd-Rüdiger Hoffmann
Der Kriminologe Tobias Singelnstein erklärte in dieser Zeitung, warum der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht zu trauen sei und verwies auf das Beispiel der dort aufgeführten Straftaten von Geflüchteten. Auch darum geht es in der jetzt als Buch erschienenen Masterarbeit von Isabella Greif und Fiona Schmidt, die sich mit den strukturellen Defiziten des staatsanwaltlichen Umgangs mit rechter und rassistischer Gewalt am Beispiel der Ermittlungen zum NSU-Komplex und dem Oktoberfestattentat von 1980 beschäftigt. Die Autorinnen zeigen, dass auch der staatsanwaltlichen Statistik nicht zu trauen sei, die im Übrigen nicht einmal mit der PKS kompatibel ist. Singelnstein fasste zusammen, dass die PKS keineswegs Auskunft über die Kriminalität im Lande gebe, sondern lediglich das polizeiliche Registrierungsverhalten abbilde. Die Zusammenfassung von Greif und Schmidt am Ende ihrer gründlichen Untersuchung lautet: »In der Struktur und Funktionsweise von Staatsanwaltschaften als zentralen Behörden der Strafverfolgung offenbart sich ein Maß an Ermessens- und Deutungsspielräumen, das der Auffassung von Staatsanwaltschaften als ›Garantin für Rechtstaatlichkeit und gesetzmäßige Verfahrensabläufe‹ entgegensteht.« Starke Worte, die ein aktuelles Thema berühren und jede Talkshow zieren könnten.
Die Aktualität des Themas, jedoch auch das politische Engagement und die beachtliche theoretische Tiefe waren die Gründe, Isabella Greif und Fiona Schmidt für diese Arbeit gleich zweimal mit Preisen der Rosa-Luxemburg-Stiftung auszuzeichnen, einmal in Brandenburg und gleich danach in Sachsen. Es besteht durchaus immer wieder die Gefahr, dass besondere Aktualität und Brisanz eines Gegenstandes dazu führen, zu sehr im Stoff gefangen zu sein oder sich von ständig neuen Schlagzeilen treiben zu lassen, so dass öffentliche Präsenz des Themas und theoretische Bearbeitung schon mal in einem Missverhältnis stehen können. Hier jedoch passt alles zusammen.
Die Autorinnen gehen von der zentralen und einflussreichen Rolle von Staatsanwaltschaften in der Strafverfolgung rechter und rassistischer Gewalt aus. Aber die Staatsanwaltschaft als »Herrin des Ermittlungsverfahrens« weise erhebliche Defizite als Institution des Rechtsstaates auf, weshalb sich am Ende der Untersuchungen noch stärker die Frage auftut, »ob eine konsequente Strafverfolgung rechter und rassistischer Gewalt in den gegebenen Strukturen überhaupt möglich ist und ob tiefgreifende Reformen diese Defizite ausgleichen können« (S. 286). Dennoch gebe es konkrete Punkte, die zukünftig gründlich zu bearbeiten wären. Nötig sei die transdisziplinäre Auseinandersetzung und Kritik an Staatsanwaltschaften und ihren Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt. Ohne Perspektivwechsel durch die Anerkennung und Einbeziehung migrantisch positionierten Wissens dürfte das jedoch unmöglich sein. Was bei diesem Perspektivwechsel, gepaart mit Engagement und wissenschaftlicher Redlichkeit, herauskommen kann, zeigt dieses Buch. Es wird detailliert nachgewiesen, dass es in der staatsanwaltschaftlichen Arbeit sowohl strukturelle Lücken gibt, allerdings auch regelrecht ideologische diskursive Strategien zum Zwecke der Absicherung der Staatsräson. Erst aus dieser Perspektive werden Zusammenhänge deutlich, die zur Erkenntnis führen, dass grundlegende Macht- und Deutungskämpfe stattfinden und deshalb das Thema als gesamtgesellschaftliches zu betrachten ist. Denn die staatsanwaltschaftliche Haltung übersetze sich in polizeiliche Ermittlungsarbeiten und den institutionellen Rassismus der Behörden und werde durch eine unkritische Medienberichterstattung gesellschaftlich verstärkt. Selbst die Fachliteratur sei gegenüber hegemonialen staatlichen Narrativen recht unkritisch.
Die Arbeit besticht dadurch, wie wichtige Begriffe einleuchtend eingeführt werden, wodurch das im Wesentlichen gleiche Muster bei den Ermittlungen zum Oktoberfestattentat und zum NSU-Komplex deutlich wird (»Positioniertes Wissen zu Rassismus«, »Dominanzkultur«, »Institutioneller Rassismus«, »Rechte und rassistische Gewalt«). »Entnennung«, »Entpolitisierung« und »Entkontextualisierung« werden als Schlüsselbegriffe eingeführt, um Strategien im staatsanwaltlichen Umgang mit rechter und rassistischer Gewalt nachzuweisen, die diese im Resultat verharmlosen. Es ist beeindruckend, wie eine logische Argumentation auf Grundlage dieses methodischen und begrifflichen Rahmens durchgehend beibehalten wird. Desillusionierend und mutig ist dieses sehr wichtige Buch, das nebenbei auch noch veranschaulicht, was ein interdisziplinärer Ansatz praktisch bedeuten kann.
Isabella Greif/Fiona Schmidt: Staatsanwaltschaftlicher Umgang mit rechter und rassistischer
Gewalt. Eine Untersuchung struktureller Defizite und Kontinuitäten am Beispiel der Ermittlungen
zum NSU-Komplex und dem Oktoberfestattentat. WeltTrends, 303 S., br., 19,90 €.
Berlin-Ausgabe vom Freitag, 23. März 2018, Seite 14
Zum Artikel auf der Homepage der Zeitschrift ...
Kwame Nkrumah und der Kalte Krieg (Rezension)
Beitrag in der Zeitschrift "Das Blättchen" [21. Jg. (2018) Nr. 1]
von Gerd-Rüdiger Hoffmann
Im Spiegel erschien 1964 ein redaktioneller Artikel über Kwame Nkrumah unter dem Titel „Diktatur – unser Messias“. Es ging um Einparteienherrschaft, Personenkult, Präsidialregime und darum, warum die Politik des damaligen ghanaischen Partei- und Staatschefs auch für andere afrikanische Länder als Vorbild beim Übergang zur Diktatur mit nationalistischem und sozialistischem Programm dienen könnte. Der Beitrag endete mit dem Satz: „Den Kontinent, dem die Freiheit geschenkt wurde, erwartet die Diktatur.“
Die aufgezählten Fakten stimmten irgendwie, aber weder Nkrumah noch Ghana kamen als Subjekte eines historischen Prozesses vor, wenn geschlussfolgert wurde, dass „die Abkehr von der Demokratie westlicher Prägung, die Briten und Franzosen nach Afrika zu verpflanzen suchten, endgültig vollzogen“ sei. Da war sie – die Sprache des Kalten Krieges. Denn: Wer sollte denn dem Kontinent die Freiheit geschenkt haben? Die europäischen Kolonialmächte, deren funktionierende parlamentarische Demokratie in Europa auf der Grundlage eines relativen Wohlstandes für viele nicht unwesentlich mit der Ausbeutung ihrer Kolonien in Afrika zu tun hatte? Hatte die Hinwendung afrikanischer Führungspersönlichkeiten – Politiker, Gewerkschafter, Künstler, Philosophen – zum Sozialismus und Marxismus nicht vielmehr damit zu tun, dass ihnen eben nichts geschenkt wurde und Verbündete im Kampf gegen die alten Mächte zu suchen waren?
Kwame Nkrumah (1909–1972) war in den 1960er Jahren nicht nur deshalb geachtet, verehrt und gehasst, weil er als erster Politiker 1957 sein Land in die Unabhängigkeit führte, sondern ebenso wegen seiner Idee einer „Philosophie und Ideologie zur Entkolonialisierung und Entwicklung mit besonderer Berücksichtigung der afrikanischen Revolution“, die er verwirklichen wollte. Nkrumah war nicht bloß pragmatischer Politiker, sondern auch Theoretiker. Zwar sollte Theorie nützlich für politische Ziele anzuwenden sein, aber eine Reduktion zum Beispiel philosophischer Überlegungen auf politischen Nutzen fand sich bei ihm nicht. „Nkrumah nahm Theorie ernst“, betonte Thomas L. Hodgkin in seinem für Présence Africaine verfassten Nachruf und sah darin ein Merkmal für die Radikalität Nkrumahs. Es liegt nahe, dass Nkrumah in einer für Umbrüche reifen Zeit offen für marxistische Thesen war.
Einfache Antworten auf ideologische Entweder-Oder-Fragen zum Wirken von Nkrumah sind gar nicht möglich. Jedoch kam der Staatsmann Nkrumah über eine „Standpunktphilosophie“ (Theodor W. Adorno) kaum hinaus, so dass es zwischen Vermittlung von Wissen und Durchsetzen des politischen Willens, Definition der Erfahrungen und Aufklärung als Staatsräson oft nur ein schmaler Grat war.
Der Historiker Ulrich van der Heyden hat auch unter diesem Blickwinkel mit seinem neuen Buch einen originellen Beitrag zu einer differenzierten Bewertung einer wichtigen historischen Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts geleistet. Er konzentriert sich jedoch auf die politische Bewertung Kwame Nkrumahs im Kontext des Kalten Krieges und unter den Bedingungen eingeschränkter Möglichkeiten, die politische, ökonomische und kulturelle Unabhängigkeit Ghanas tatsächlich souverän zu gestalten. Ost und West nahmen Einfluss und sahen Ghana wie Afrika insgesamt als Projektionsfläche für ihre Vorstellungen. Es ging um Einflusssphären in der Systemauseinandersetzung. Während es jedoch im Westen mehr um den Erhalt von politischem Einfluss ging, galten in den sozialistischen Ländern die nationalen Befreiungsbewegungen auch als Hoffnungsträger für eine Erneuerung und Internationalisierung des Sozialismus und Marxismus. In offiziellen Verlautbarungen war davon jedoch kaum etwas zu lesen, in den Vorlesungen der Leipziger und Berliner Afrikawissenschaftler durchaus. Auch Christian Mährdel, der im Buch als Beispiel eines orthodoxen Vertreters der Afrikanistik genannt wird, hat in Leipzig und ab 1991 in Wien zu kritischer und genauer Beschäftigung Studierender mit Afrika beigetragen. Doch der Grundmangel des Lehrbuch-ML war ein Geschichtsmodell, das auf den Sieg des Sozialismus ausgerichtet war und irgendwie versuchte, antikolonialistische und nationale Befreiungsbewegungen in den als gesetzmäßig aufgefassten Ablauf der Weltgeschichte einzupassen. Diese Sicht wurde erst langsam ab Ende der 1970er Jahre infrage gestellt, in Leipzig vor allem in Soziologie- und Philosophieseminaren.
Der Afrikahistoriker van der Heyden begibt sich nur selten auf das Feld theoretischer Debatten dieser Zeit. Vielmehr setzt er sich mit Akten und dokumentierten Ereignissen auseinander. Vor allem aber beschäftigt er sich mit der politischen Bewertung der Politik Kwame Nkrumahs und den damit verbundenen Fehleinschätzungen sowie Wunschvorstellungen von Politikern und Wissenschaftlern der DDR in den 1960er Jahren und weit darüber hinaus. Die politische Radikalisierung Nkrumahs hatte jedoch nicht nur mit falscher Beratung und eigenen politischen Fehleinschätzungen zu tun. Bei einem allzu engen Bündnis mit der DDR zum Beispiel hätte Ghana mit „ökonomischer Vergeltung“ durch die BRD rechnen müssen. Das wusste auch Nkrumah. Darauf weist der Autor hin und berichtet über Ereignisse und Zusammenhänge, in denen es immer wieder um die Konkurrenz zwischen DDR und BRD in Westafrika geht. Selbst die Nachrichtendienste werden differenziert beschrieben, ohne die heute meist übliche Dämonisierung des DDR-Geheimdienstes. Erinnert wird auch an die Hallstein-Doktrin, mit der die BRD lange erfolgreich die internationale diplomatische Anerkennung der DDR verhinderte.
Das praktizierte europäische Sozialismusmodell konnte für Linke im Westen kaum als leuchtendes Vorbild für eine zukünftige sozial gerechte und demokratische Gesellschaft gelten. Dieses Dilemma traf auch Nkrumah und andere Politiker der afrikanischen Befreiungsbewegung. Das war aber etwas Anderes als die pauschale Verurteilung Nkrumahs als Diktator im erwähnten Spiegel-Artikel oder von links außen als „Diener des Imperialismus“.
Ulrich van der Heyden: Kwame Nkrumah – Diktator oder Panafrikanist? Die politische Bewertung des ghanaischen Politikers in der DDR im Spannungsfeld der deutsch-deutschen Konkurrenz in Westafrika, WeltTrends, Potsdam 2017, 86 Seiten, 14,90 Euro.
Zum Artikel auf der Homepage der Zeitschrift ...
Jenseits des Weltschmerzes - Die »Ostrale« in Dresden verzeichnete 2016 einen Besucherrekord. Wie es weitergeht, ist offen
Beitrag in der Zeitung "neues deutschland" (Feuilleton, S. 15)
von Gerd-Rüdiger Hoffmann
Die 11. Internationale Ausstellung zeitgenössischer Künste »Ostrale« in Dresden wird vom 28. Juli bis 1. Oktober 2017 stattfinden. Diese Auskunft zum Abschluss der nunmehr bereits zehnten, in den ästhetischen Handschriften wiederum sehr vielfältigen, sehr weltoffenen und im politischen Anspruch besonders kapitalismuskritischen Ostrale 2016 überrascht nicht.
Keine Überraschung war auch das bedeutungsschwere Thema »error:x« der zehnten Auflage der Ausstellung. Dabei ging es nicht darum, dass man irgendeinen x-beliebigen Irrtum korrigieren sollte. Es geht um mehr, betont die Direktorin Andrea Hilger: »Seit der Künstler Peter Puype schrieb: ›Demokratie für den Westen, Gewalt für den Rest‹, fragen wir nach Alternativen der Art und Weise unseres Daseins, aber solange wir funktionieren in unseren Systemen, vergessen wir die Konsequenzen unseres Konsums und unserer heutigen Werte. Wir alle wissen, dass diesem System ein Fehler vorliegt - error:x.«
Wenn auch im Folgenden auf einzelne Kunstwerke nicht näher eingegangen werden kann, weil leider über Anderes zu berichten ist, so sei dennoch gesagt, dass die Schau diesem Anspruch nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch gerecht wurde. Auf 20 000 Quadratmetern wurden Werke von etwa 200 Künstlern aus 42 Nationen mit teilweise sehr direktem Bezug zum Thema gezeigt. Dass der Katalog noch nicht vorliegt, allerdings wiederum als gelungene Edition noch zu erwarten ist, überrascht auch nicht. Eine böse Überraschung ist, dass zum Abschluss Ende September noch nicht gesagt werden konnte, wo die nächste Ausstellung stattfinden und wie oder ob es weitergehen wird mit einer der interessantesten Kunstausstellungen in Deutschland.
Der Oberbürgermeister Dresdens, Dirk Hilbert (FDP), erklärte als Schirmherr zur Eröffnung im Juli 2016 zwar, dass die Ostrale gut zu Dresden passe, weil sie »vielgestaltige internationale Facetten in die Stadt an der Elbe« bringe, »der mitunter ein barock-behäbiger, sogar antiquierter Habitus nachgesagt wird«. Einmal davon abgesehen, dass Dresden in Sachen Habitus aktuell gegen einen ganz anderen Ruf zu kämpfen hat, ist es die Stadt Dresden selbst, die jetzt als Eigentümer ihre Immobilie an Dritte verkaufen will. Die von 1906 bis 1910 erbauten und heute denkmalgeschützten Futterställe im Ostragehege sind seit Jahren sanierungsbedürftig. Das ist nicht mehr mit flotten Sprüchen über den maroden Charme der Ausstellungsräume kleinzureden. 4,5 bis 5 Millionen Euro werden wohl für die Sanierung nötig sein.
Der außerordentliche künstlerische Erfolg der Ostrale ist die eine Seite, wirtschaftlich war sie schon immer ein fragiles Unternehmen. Das Budget liegt bei etwa 550 000 Euro. »Das ist im Vergleich zu ähnlichen Ausstellungen dieser Größe eine Lachnummer«, sagt der Schatzmeister des Fördervereins, Bernd Kugelberg. Lediglich 59 000 Euro kommen von der Stadt, wobei mit diesem Geld wiederum Miete und Nebenkosten an die Stadt zurückzuzahlen sind. Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD), ebenfalls Schirmherrin, erklärte im August während eines Besuches in der Ausstellung: »Ich wünsche der Ostrale und der Stadt Dresden, dass ihre gemeinsame inspirierende Geschichte auch künftig fortgesetzt werden kann.«
Doch merkliche finanzielle Unterstützung gibt es vom Freistaat Sachsen nicht und wird wohl auch zukünftig nicht zu erwarten sein. So kann die Ostrale weder den Kaufpreis aufbringen, noch ist damit zu rechnen, dass ein neuer Eigentümer nach der Sanierung einen bezahlbaren Mietpreis akzeptieren wird. Die einzig sinnvolle Lösung wäre, von der Privatisierung abzulassen und gemeinsam mit erfahrenen Kuratoren ein Konzept für die Weiterentwicklung dieser Kunstschau zu erarbeiten.
Nur durch risikobereites und weitgehend ehrenamtliches Engagement konnte der ehemalige Städtische Vieh- und Schlachthof im Ostragehege durch diese »Zwischennutzung« nicht nur vor dem Verfall gerettet, sondern so aufgewertet werden, dass es sich heute um eine begehrte Immobilie handelt. Schmuck renovierte Gebäude der Nachbarn legen davon Zeugnis ab. Die reichen Nachbarn profitierten von den guten Ideen der armen Künstler. Gut vorstellbar, dass sie jetzt für die Erweiterung ihres Unternehmens von der Stadt gern die maroden Reste auch noch kaufen wollen. Zu hören ist, dass die Kunstschau bei den Überlegungen über die Zukunft des Areals keine Rolle spielte, auch nicht vonseiten des Bauamtes der Stadtverwaltung.
In der Bewerbung als »Europäische Kulturhauptstadt 2025« findet sich der ausdrückliche Hinweis auf die Ostrale. Kreativität, Überraschendes und sehr gute Kontakte über Sachsen und Deutschland hinaus sorgen für internationale Anerkennung und ein positives Dresdenbild. Denn nicht nur mit Poznań und Wrocław gibt es Partnerschaften. Ein wichtiger Schwerpunkt ist Afrika, wobei eben nicht exotisches Beiwerk gefragt ist, sondern originäre Beiträge von Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika, einschließlich Nordafrika.
Zum Beispiel war lange vorher für das im Oktober 2016 geplante Gemeinschaftsprojekt »Fundamental - 5. Mediations Biennale« in Poznań vorgeschlagen, sich angesichts zunehmender Migration mit grundsätzlichen Fragen wie Freiheit, Identität und Integrität von Gesellschaften und Kulturen im Dialog mit 50 Künstlern aus Kenia, Ghana, Kongo, Senegal, Simbabwe, Indonesien, Israel, Japan, Kuba, Russland und 20 Künstlern aus Polen zu beschäftigen. Deshalb wäre eine Reduzierung der Ostrale-Aktivitäten ein Verlust für die Künste in Europa und weit darüber hinaus.
Es handelt sich hier um politisch engagierte Kunst, die trotz immer wieder recht allgemeiner Themenstellungen eben nicht in Beliebigkeit abgleitet, auch nicht mit Bezug auf ästhetische Standards. Der Kunstmarkt ist interessiert, doch »Siegerkunst« ist nicht gefragt, die Ausschreibungen sind als besonders fair bekannt, Jurysitzungen sind öffentlich, Eventkunst dominiert nicht gegenüber Malerei, Plastik oder Fotografie, wohl aber sind auch andere Künste dabei. Und die Ostrale hat eine erfrischende Form des Miteinanders mit Besucherinnen und Besuchern gefunden.
»Atelier der Dinge« heißt der Raum, in dem man selbst kreativ tätig werden kann. Es geht nicht um plakatives Reagieren auf Pegida oder um das Mitmachen beim Werben um einen »positiven Patriotismus«, sondern ein der Demokratiefeindlichkeit entgegengesetztes Agieren. Und das ist seit zehn Jahren organischer Bestandteil der Ostrale. Deutlicher Ausdruck dafür ist der Umgang mit afrikanischer zeitgenössischer Kunst. Denn im Vergleich mit anderen großen Ausstellungen, die Afrika im Titel tragen, sind hier afrikanische Künstlerinnen und Künstler nicht Objekte westlichen Weltschmerzes, sondern wichtige Dialogpartner, die selbstverständlich mit den weltweit allen Künsten eigenen speziellen Mitteln Wesentliches zu den Fragen unserer Zeit beitragen.
In diesem Jahr schloss die Ostrale am 25. September mit einem Besucherrekord von 25 000 Besuchern. Weitere 17 000 haben die Ausstellung »Ostrale weht Oder« in Wrocław gesehen. Nach neuestem Stand sieht es so aus, dass die Ostrale 2017 letztmalig in den unsanierten Futterställen stattfinden wird. Die ersten Kuratoren sind bereits gewonnen. In den Folgejahren soll die Ausstellung dann als Biennale fortgeführt werden. Für die Direktorin Andrea Hilger heißt das, dass das Ostrale-Kollektiv angesichts der knappen finanziellen Unterstützung weiterhin gezwungen ist, seine »Kreativität ständig für die Lösung existenzieller Probleme zu instrumentalisieren. Gern würden wir uns künftig wieder positiv und mit den nötigen Freiheiten dafür einsetzen können, in Dresden auch weiterhin eine weltweit geachtete Ausstellung zeitgenössischer Kunst in der Kulturstadt Dresden zu gestalten.«
Zum Artikel auf der Homepage des nd ...
Ein „Windrad auf dem Dach“ für Jurij Koch - Rezension von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
Beitrag in der Zeitschrift "Das Blättchen" [20. Jg. (2017) Nr. 1]
von Gerd-Rüdiger Hoffmann
Jurij Koch, geboren am 15. September 1936, hat nach „Das Feuer im Spiegel“ (2012) in Obersorbisch und in Deutsch noch ein Buch geschrieben, das wieder kein Tagebuch ist, sondern von ihm ausdrücklich „Erinnerungen“ genannt wird. Der Unterschied ist wichtig, denn so erfahren wir nicht unbedingt, was an diesem oder jenem Tag im Jahre 1949 zum Beispiel von ihm notiert wurde und welche Meinung er zu dieser oder jener Begebenheit genau an diesem Tag hatte, sondern wir bekommen damit zu tun, woran sich Jurij Koch erinnert und wie die Sache nach seiner Meinung heute zu bewerten sei. Wir erfahren auch von seinem Wundern darüber, wie er so manchen „Mischmasch noch mit reichlich sechzigjährigem Abstand zum erinnerten Vorfall“ wahrnimmt. Jedoch schreibt er auch: „Wobei ich mir nicht sicher bin, dass wirklich alles so geschehen ist. Was die Fantasie vor und während dieser Schriftlegung hinzugefügt hat. Macht nichts. Auf jeden Fall könnte es so gewesen sein.“ An einige Einzelheiten, für die sich Historiker bestimmt interessiert hätten, erinnert er sich nicht, wundert sich ebenfalls darüber und findet es nicht schlimm. Diese Sicht und die Kommentare aus der Jetztzeit zu früheren Erlebnissen und Taten, die ganz und gar nicht aufgeschrieben sind, um sich vor heute herrschendem Zeitgeist zu rechtfertigen oder die jungen Leute zu belehren, machen das Lesen zu einem besonderen Erlebnis. Witz und Klugheit treffen sich. Wahrhaftigkeit findet hier statt. Das muss über Jurij Koch gesagt werden, der sich immer auch als Journalist versteht.
Wenn er merkwürdige Begebenheiten, also Merkwürdigkeiten, aufzählt, dann sind das Geschichten zur Geschichte der Lausitz und seines Lebens, in denen Heimat und Welt vorkommen und wie es um sie steht nach seiner Meinung. Zum Beispiel wie er nach dem Krieg als Entwicklungshilfe für sorbische Kinder „notreife Bildung“ im tschechischen Varnsdorf erhielt, die Zeit im sorbischen Gymnasium Bautzen und etwas später am niedersorbischen Gymnasium in Cottbus, nachdem das Einsammeln von Mobiliar und Kindern in den umliegenden wendischen Dörfern erfolgreich war.
Um die erste Liebe und so geht es natürlich auch. Politische Umstände im geteilten Deutschland gehen hier dazwischen: „Greta“, „Abgehauen! Rüber!“.
Sodann das Erinnern an „Brandenburgs SED-Landesvorsteher Friedrich Ebert“, der einer sorbischen Abordnung „patzig zu verstehen gab, dass die eingesessene brandenburgische Arbeiterklasse nicht gewillt sei, im Land eine Treibhauspflanze aufzuziehen“. Auch die spätere „Gesinnungsumkehr“ in dieser Frage kommt zur Sprache. Freilich, um das kleine Völkchen der Sorben, das in der Niederlausitz gern Wenden genannt werden will, geht es immer wieder. Jurij Koch will nicht darauf reduziert werden, obwohl er weiß, dass Intellektuelle dieser kleinen Minderheit das Privileg haben, sorbische Heimat und Welt in einer einmaligen Art zusammenzubringen. Dagegen stemmt sich die Arroganz der Deutschen, die fest davon überzeugt sind, dass einzig sie den Fortschritt verkörpern. Denn wenn auch kaum geglaubt wurde, was auf Plakaten geschrieben stand, mit dem Spruch „Ich bin Bergmann, wer ist mehr“ (ohne Fragezeichen) war es anders. Das war Volksglauben und ließ keine Kritik am Wegbaggern der sorbischen Dörfer im Namen des Fortschritts zu. Verständlich, dass sich auch Sorben auf die Seite der vermeintlichen Sieger schlugen und ihre Sprache und Kultur verleugneten. Anders Jurij Koch, bereits als Schüler: „Meine auf dem tschechischen Gymnasium erworbenen Fähigkeiten, mit Buchstaben in drei, vier Sprachen schnell, in der eigenen wieselig flink, umzugehen, und das angesammelte Häufchen Wissen, welche Ordnungen die Welt im Inneren zusammenhalten, haben mich plötzlich zu einem Klugscheißer gemacht, der im Mittelpunkt steht. Und daran durchaus Gefallen findet.“ Was nicht ohne Risiko ist, wie er sich ebenfalls erinnert.
Oder die Merkwürdigkeit wie Jurij Koch als junger Kerl gemeinsam mit dem Striesower Bürgermeister und dem Gemeindekalfaktor den „kaisertreuen Vogel“ vom Sockel des Kriegerdenkmals holt. Heute freilich, so bemerkt Jurij Koch, sitzt das Vieh wieder „auf dem gereinigten Denkmalsockel mit neuem Nagel im Arsch […] Und zu den Namen der Gefallenen des Ersten Weltkriegs sind die des Zweiten hinzugemeißelt. Wobei darauf hingewiesen sei, dass für weitere auf den Steinflächen des Denkmals kein Platz mehr vorhanden ist.“
Schließlich Jurij Kochs Rede auf dem Schriftstellerkongress im November 1987. Der Autor dieser Bemerkungen war zu jener Zeit am Afrikabereich der Karl-Marx-Universität Leipzig mit Vorlesungen über Frantz Fanon beschäftigt, der uns Europäern mit unserem Begriff von Fortschritt den Spiegel vorhielt. „Europa ist im Eimer.“ Sartre gibt Fanon Recht mit seiner vernichtenden Kritik. „Der Engel der Geschichte“ – nicht erst in den späten 1980er Jahren begannen wir Walter Benjamin zu lesen, jedoch bekam zu dieser Zeit so manche seiner Ideen mehr Kraft im Reden, Lernen und Lehren an der Karl-Marx-Universität. Ernst Bloch schwebte ohnehin durch alle Seminarräume der Philosophie. Dafür sorgte allein die Anwesenheit des Philosophiehistorikers Helmut Seidel, der den Namen des aus Leipzig von ideologischen Kleingeistern vertriebenen Bloch zwar kaum erwähnte und doch irgendwie eben diesen anderen Marxismus, den schöngeistigen und lebensphilosophischen über uns brachte. Es war mehr ein Gefühl, dass Benjamin und Bloch und Rosa Luxemburg und auch ein etwas anders als im Grundlagenstudium gelesener Karl Marx uns viel zur Lage im Lande und in den Lüften zu sagen hatten. Und dann Jurij Koch auf dem Schriftstellerkongress der DDR, mutiger oder vielleicht auch bloß naiver als sein sorbischer Kollege Jurij Brězan, jedenfalls anders als er: „Wider die anerzogene eigene Fortschrittsgläubigkeit frage ich nach dem Verhältnis von Gewinn und Verlust. Wie viel verlieren wir, wenn wir so viel gewinnen? Mit jeder Kalorie Wärme, die wir der Erde entnehmen, um sie zu verschwenden, wird es kälter um uns.“ In Funktionärsstuben und im Braunkohlekombinat soll es daraufhin die gehässige Bemerkung gegeben haben, die auch Jurij Koch zu Ohren kommt, „dass es angebracht wäre, dem Koch ein Windrad aufs Dach zu setzen. Soll er sehen, wie er zu Wärme und Licht kommt.“ Im Spiegel, der im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer Chronologie „Subsaharisches Afrika“ auszuwerten ist, erfahre ich zuerst von der Koch-Rede, zitiere ihn, nein interpretiere mehr, weil ich ja die ganze Rede nicht kenne, und werde zu einem Gespräch geladen. Keine Drohung oder Kritik beim Parteisekretär (oder war es die Abteilungsleiterin?), sondern fast Respekt und Anerkennung. Zum Schluss der Unterredung jedoch noch dieses obligatorische „Muss-das-denn-sein“. Beim Lesen des Spiegel-Artikels ahne ich es, Jurij Koch bestätigt es in seinem Buch, dass Hermann Kant es war, der ihn damals ermunterte, von seiner Meinung nicht abzulassen, nicht sein Stellvertreter im Schriftstellerverband Brězan.
Das Buch schließt mit Erinnerungen an den Spätherbst 1989, „als es im Gebälk der Republik knistert“, Jurij Koch in einer der vielen Versammlungen gebeten ist, „den Moderator zu spielen“ und jemand nach Abrechnung „ohne zu fackeln“ ruft. Jurij Koch, mit über 50 noch immer nicht darauf bedacht, mehrheitliche Zustimmung zu erheischen: „Ich unterbreche den Schreihals. Mir scheine, dass in diesen Zeiten des Aufstands der Kleinbürger diejenigen die größte Klappe haben, die sie vor Wochen noch fest verschlossen hielten.“
Es stimmt schon, das Buch handelt von „aus heutiger Sicht kauzig anmutenden Begebenheiten, die sich zu einem Bild der Zeit formieren“.
Jurij Koch: Windrad auf dem Dach. Erinnerungen, Domowina-Verlag, Bautzen 2016, 133 Seiten, 14,90 Euro. Jurij Koch: Wětrnik na třěše. Dopomnjeća na młode a zrałe lěta, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2016, 116 Seiten, 12,90 Euro.
Zum Artikel auf der Homepage der Zeitschrift ...
In der Sonne von Bozen. Das Siegesdenkmal in Bozen und sein Dokumentationszentrum als Versuch, die komplexe Geschichte des Faschismus in Südtirol zu verarbeiten
Beitrag in der Zeitschrift "Volksstimme. Politik und Kultur" 11/2016
Völlig zu Recht erhielt das im Oktober 2014 eröffnete Warschauer Museum „POLIN – Museum zur Geschichte der polnischen Juden“ den Europäischen Museumspreis 2016, denn hier werden neue Maßstäbe bei der Vermittlung historischer Zusammenhänge gesetzt. Auch unter museumspädagogischen und gestalterischen Geschichtspunkten hat dieses Museum Herausragendes zu bieten. Dazu passt scheinbar gar nicht, dass die internationale Expertengruppe zur Verleihung dieses begehrten Preises auch ein vor zwei Jahren eröffnetes sehr umstrittenes Museum mit einer lobenden Erwähnung bedachte, nämlich das Dokumentationszentrum unter dem sanierten faschistischen Siegesdenkmal in Bozen.
Ausgezeichnete Verklärung?
Über diese Auszeichnung freut sich der Historiker Andrea Di Michele. Als Archivar bei der Stadtverwaltung Bozen hat er am Konzept für das Dokumentationszentrum mitgearbeitet. Jetzt ist er Wissenschaftler an der Freien Universität Bozen. Während unseres Gesprächs in der Außenstelle in Brixen verweist er auf beachtliche Besucherzahlen. Auch Touristen und Schulklassen kommen, um sich mit einem besonders brisanten und unübersichtlichen Abschnitt der Geschichte zu beschäftigen. „Die lobende Erwähnung der europäischen Expertenkommission hat uns neuen Mut gegeben. Denn es war nicht von Anfang an klar, dass dieses Projekt erfolgreich im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit der Zeit zwischen 1928 und 1945 werden könnte“, sagt Di Michele. Die zahlreichen faschistischen Denkmäler in Südtirol werden noch immer seltsam verklärt von vielen angenommen. Und wohl in keiner anderen Region liegen die Erinnerungskulturen, vor allem gespalten nach Sprachgruppen, soweit auseinander wie in Südtirol.
Das Siegesdenkmal springt ins Auge, sobald man von der Bozener Altstadt über die Museumsstraße kommend die Talfer Brücke erreicht hat. Es ist das erste Bauwerk in der nach 1925 errichteten Neustadt. Es ist jedoch nur eines der zahlreichen architektonischen Hinterlassenschaften aus der sogenannten Periode „ventennio fascista“, wie die Zeit von 1925 bis 1945 genannt wird. Das Siegesdenkmal wurde 1928 mit großem Pomp eingeweiht. Entworfen von Marcello Piacentini (1881 – 1960) sollte es nach dem Willen Benito Mussolinis (1883 – 1945) an den zum Märtyrer hochstilisierten Cesare Battisti (1875 – 1916) erinnern. Battisti, Abgeordneter im Reichsrat von Österreich-Ungarn und des Tiroler Landtages, kämpfte ab 1915 mit Kriegseintritt Italiens als Freiwilliger gegen die Habsburger. Bereits ein Jahr später wurde er von österreichischen Truppen gefangen genommen und auf entwürdigende Weise wegen Hochverrats hingerichtet. Seitdem ist Battisti Projektionsfläche für nationalistische Interpretationen auf beiden Seiten. Witwe und Tochter verhinderten 1928, dass er, der einstmals sozialistische Abgeordnete, allzu sehr von den Faschisten vereinnahmt wurde. Trotzdem schmücken seine Büste und zwei weitere von Vertretern des Irredentismus das Siegesdenkmal. Über solche Ungereimtheiten setzen sich die Faschisten und Neofaschisten hinweg. Sie machten ein Denkmal für alle ihre erhofften Siege daraus, nicht bloß für den Sieg der Italiener über die Habsburger 1918. Es wurde ihr mit Mythen belegtes Denkmal und Symbol der panitalienischen Ideologie des Irredentismus, die sich in Bozen naturgemäß gegen die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols, gegen die Zugehörigkeit zu Österreich oder gegen südtirolische Autonomiebestrebungen richtete. Selbst die Lüge, dass Battisti nicht nur Märtyrer, sondern auch Kopf dieser Bewegung wäre, schadete dem Symbol nicht. Doch Battisti war nie für den Anschluss Südtirols an Italien. Die Ladiner als Minderheit wurden von den Faschisten weitgehend ignoriert oder als anders sprechende Italiener betrachtet. Deshalb ist es besonders wichtig, dass doch noch ein Ausstellungsführer in ladinischer Sprache erschien, nachdem auf das Ladinische bei der Beschriftung der Ausstellung leider verzichtet wurde.
Tempel des Faschismus
Die Komplexität der Probleme mit dem Siegesdenkmal wurde über Jahrzehnte kaum rational diskutiert. Wahrnehmung und Wirkung, so meint Andrea Di Michele, ergebe sich jedoch aus einer Mehrdeutigkeit, die je nach politischer Absicht von jeweils unliebsamen Elementen „befreit“ wird.
Erstens ist das Siegesdenkmal als „Tempel des Faschismus“ mit starker Symbolkraft auch für die popagierte Überlegenheit des Italienischen gegenüber den Anderen belegt. Einige antifaschistische Gegenreaktionen bewegen sich jedoch durchaus im konservativ-nationalistischen Gedankengut derjenigen, die „italienisch“ mehr oder weniger synonym zu „faschistisch“ verwenden, einige vielleicht sogar in der Nähe des Gedankengutes von Neofaschisten bzw. Neonazis zu lokalisieren wären.
Zweitens ist es ein Kriegerdenkmal für die gefallenen Italiener des Ersten Weltkrieges. Um es vor dem eventuellen Abriss zu bewahren, erfuhr diese Mystifikation nach 1945 einen besonderen Schub.
Drittens schließlich wird das Siegesdenkmal als bedeutendes Gesamtkunstwerk italienischer Bildhauer und Architekten des 20. Jahrhunderts akzeptiert. Das ist für an Kunstgeschichte und Dialektik geschulte Menschen schwer verständlich. Denn die profaschistische Haltung des Architekten lässt sich nicht leugnen. Doch auch dieses Herangehen könnte eine besondere Variante der Entschärfung faschistischer Symbole im Bozener Kontext sein. Es bleibt ein schwieriges Thema.
Diese Punkte sollten stets gemeinsam bedacht werden, um überhaupt die Wirkmächtigkeit und das Konfliktpotential erfassen zu können, so Di Michele. Im März 2011 wurde eine Kommission eingesetzt, die weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Konzeption erarbeiten sollte. Das mag seltsam oder gar undemokratisch erscheinen. Linken fehlen auch klare antifaschistische Formulierungen. Doch wer sich die letzten siebzig Jahre der Geschichte Südtirols in Erinnerung ruft, dürfte dafür Verständnis haben. Anders wäre ein akzeptables Ergebnis wohl nicht zustande gekommen. Denn richtig wird in einem Arbeitspapier der Kommission vom 2. Mai 2011 festgestellt, dass „das Siegesdenkmal bis heute ein Element zivilgesellschaftlicher Trennung“ darstellt.
Ein Denkmal, zwei Diktaturen
Das Dokumentationszentrum befindet sich unter dem Denkmal in einer weiträumigen Gruft. In den vier Eckräumen wird auf einer Metaebene Allgemeines zum Thema Denkmal gesagt sowie der Architekt Piacentini kritisch gewürdigt. Dreizehn thematische Räume behandeln Einzelthemen der Geschichte, aber auch die Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen in Bozen und Südtirol und mit politischen Strategien des italienischen und deutschen Faschismus. Auch die Frage „Erhalten oder schleifen?“ wird behandelt. Im Vorraum werden die vor Nationalismus strotzenden Fresken durch Zitate von Bertolt Brecht, Hannah Arendt und Thomas Paine eindrücklich konterkariert.
Die Jury, die das Dokumentationszentrum „BZ ’18 – ’45“, wie es jetzt heißt, auszeichnete, hob besonders die mutige Auseinandersetzung mit einem Thema hervor, „welches für viele Jahre im Mittelpunkt politischer Streitfragen und regionaler Identitätssuche gestanden hat“. Aufklärerische Ausdauer ist jedoch gefragt. Das sehen nicht alle so. Die seit über zehn Jahren existierende neofaschistische Partei und Bewegung „CasaPound“ stört die Leuchtschrift „BZ ’18 – ’45. Ein Denkmal, eine Stadt, zwei Diktaturen“. Für die Anhänger dieser Partei, die sich als die „Faschisten des dritten Jahrtausends“ verstehen und sich auf den Gründungsmythos der 1920er Jahre berufen, kann das Siegesdenkmal jedoch nicht mehr „ihr Denkmal“ sein. Da helfen auch nicht gegenteilige Behauptungen und provokative Aufmärsche wie kurz nach Eröffnung im Juli 2014 oder die demonstrative Kranzniederlegung am 12. Juli 2016 anlässlich des einhundertsten Jahrestages der Hinrichtung von Cesare Battisti. Mit „ihrem“ bisher geheimnisvoll belegten Symbol geht es wahrscheinlich langsam zu Ende. Das Denkmal wird durch das Dokumentationszentrum und äußerlich durchaus auch durch den Leuchtring depotenzialisiert. Und wahrscheinlich ist diese Art der argumentativen Auseinandersetzung nachhaltiger als der zu lobende und dennoch gescheiterte Versuch im Jahre 2002, den Siegesplatz in Friedensplatz umzubenennen.
Depotenzialisiert
Bestimmt ist diese Politik erfolgreicher als die Forderung nach Abriss des Denkmals. Zu bedenken ist auch, dass auch Neonazis für den Abriss sind, weil sie den Beginn der „zweiten Diktatur“ unter den deutschen Nazis als Befreiung vom Faschismus feiern, dann wird die Unübersichtlichkeit komplettiert. Auch in diesem Zusammenhang erscheint die im Gespräch mit mir geäußerte Meinung des Historikers Di Michele richtig, dass ein Begriff vom Faschismus als Oberbegriff für die jeweiligen Selbstbezeichnungen „italienischer Faschismus“ und „Nationalsozialismus“ für komparative Studien und Forschungen zweckmäßig ist.
Bozen und Warschau ist gemeinsam, dass in beiden Einrichtungen auf Aufklärung gesetzt wird, von mündigen Bürgerinnen und Bürgern ausgegangen und auf jede Art von „Überwältigungsdidaktik“ verzichtet wird. So kann gegen die ideologische Sprengkraft von Mystifikationen wie auch gegen die Hilflosigkeit rationaler Argumentation angegangen werden. Depotenzialisierung im Sinne von Entmachtung, die Wirkung nehmen, ist ein passender Ausdruck dafür. Die Pläne der Stadt sehen vor, diesen Weg weiterhin zu versuchen. Demnächst soll das Mussolini-Relief am Finanzamt mit dem Hannah-Arendt-Zitat „Niemand hat das Recht zu gehorchen“ depotenzialisiert werden. Stolpersteine in Bozen erinnern ebenfalls seit einigen Jahren leise, aber nachhaltig, an ein noch immer verklärtes oder verdrängtes Kapitel südtirolischer Geschichte.
Zur Homepage der Zeitschrift ...
Senftenberg ist Zły Komorow, nur beschlossen ist es (noch) nicht
Kommentar zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 9. März 2016 zum fraktionsübergreifenden Antrag
Eine Mehrheit der in der Stadtverordnetenversammlung Senftenberg / ZłyKomorow erkennt an, dass die Stadt die gesetzlich festgelegten Kriterienfür die Zugehörigkeit zum sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet erfüllt. Trotzdem wurde ein entsprechender Antrag abgelehnt.
Gestern, am 9. März 2016, stand als Punkt 1.15 der Stadtverordnetenversammlung Senftenberg auf der Tagesordnung „Antrag zur Feststellung der Zugehörigkeit der Stadt Senftenberg zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden - Antrag mehrerer Stadtverordneter“. Das neue Sorben/Wenden-Gesetz legt fest, dass Gemeinden, die bisher nicht als Bestandteil des Siedlungsgebietes aufgelistet sind, nach Prüfung eines entsprechenden Antrages bis Mai 2016 aufgenommen werden können. Den Antrag können die Gemeinden selber, der Sorben/Wenden-Rat beim Landtag oder beide gemeinsam stellen. Die einflussreiche Mitwirkung der Kommunen wurde durch Druck der kommunalen Spitzenverbände des Landes Brandenburg erwirkt. Die Entscheidung trifft das zuständige Ministerium in Potsdam, wobei eine nochmalige Anhörung im Hauptausschuss des Landtages vorgesehen ist. Als Kriterium für die Aufnahme gilt, dass eine kontinuierliche sprachliche oder kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweisbar sein muss.
Dieses Kriterium ist für Senftenberg/Zły Komorow erfüllt. Das sieht auch die Mehrheit der Stadtverordneten so, so dass damit zu rechnen war, dass der von vier Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen (CDU, DIE LINKE, SPD, UWS) eingereichte Antrag beschlossen wird. Es kam anders. Bei zwei Enthaltungen stimmten 14 der anwesenden Abgeordneten dafür und 14 dagegen, also Ablehnung. Ob nun Zufall oder nicht, zumindest bei den Sozialdemokraten nicht unüblich, die zwei Befürworter des Antrages in der SPD-Fraktion fehlten bei der Sitzung. Die SPD war es auch, die das Ansinnen der Initiatorin dieses Antrages Dr. Gudrun Andresen (CDU), den anwesenden Sorben/Wenden Rederecht zu erteilen, verhinderte. Damit konnten im weiteren Verlauf der Sitzung peinliche Uninformiertheit, Unkenntnis des Sorben/Wenden-Gesetzes und Falsches zum Thema „Sorben oder Wenden“ nicht richtiggestellt werden. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Reiner Rademann (SPD) berief sich gar auf „Empirisches“. Er hätte sich in der Stadt umgehört und nur eine Person gefunden, die der Meinung war, das könne man so machen mit dem Siedlungsgebiet. Alle anderen hätten das Ansinnen kategorisch abgelehnt. Es gäbe doch wohl andere Probleme. Klares Fazit für Rademann: Da eine Mehrheit Senftenberg nicht als Bestandteil des sorbischen/wendischen Siedlungsgebietes haben wolle, müsse es auch ein klares Votum bei den Abgeordneten geben. Damit steht dieser Abgeordnete als Musterbeispiel für die Probleme, die im Umgang mit der relativ fortschrittlichen Minderheitenpolitik des Landes Brandenburg immer wieder bei Behörden und Abgeordneten aller Ebenen zutage treten.
Zuerst ist das Unkenntnis der Gesetzeslage. So ist zum Beispiel immer wieder die Rede davon gewesen, dass doch die Domowina den Antrag stellen solle. Im Gesetz ist das natürlich nicht vorgesehen, handelt es sich doch bei der Domowina um einen Verein. Die Unkenntnis internationaler Vereinbarungen, die in Deutschland verbindlich gelten, wird nicht einmal als Defizit empfunden. Kein gutes Zeichen für den europäischen Gedanken.
Weiterhin ist erschreckend, wie die Bemühungen zur Belebung der sorbischen/wendischen Kultur der in der Stadt und in der Region lebenden Wenden ignoriert wird. Auch die Domowina-Gruppe der Stadt wurde bei Anhörungen in Fraktionen immer wieder unter Rechtfertigungsdruck gesetzt. Dabei spricht allein die Anzahl der Aktivitäten in der Stadt für sich. Vom Niedersorbisch-Unterricht an einer Oberschule, gut besuchten Sprachkursen, Lesungen, Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen bis zum regelmäßig stattfindenden zweisprachigen Gottesdienst in der Wendischen Kirche reicht das Angebot.
Schließlich wird der tiefe Sinn der Minderheitenpolitik des Landes wohl nicht verstanden: Es ist quasi die Krone der Demokratie, wenn gegenüber Interessen von Minderheiten sehr bewusst vorgesehen ist, dass eine Mehrheit nicht die Macht der größeren Zahl in Anschlag bringen sollte, sondern dass die Minderheiteninteressen zu schützen sind.
Hier liegt der rationale Kern der „Bauchschmerzen“ von Bürgermeister Andreas Fredrich (SPD), wenn er es als bedenklich ansieht, dass eine Mehrheit über eine Minderheit befinden soll. Inzwischen, so scheint es, geht auch er davon aus, dass seine Stadt die Kriterien für die Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet erfüllt. Wenn die Sorben/Wenden-Vertretung auf Landesebene einen entsprechenden Antrag stellt und dieser Antrag positiv vom Land beschieden wird, dann ist wohl damit zu rechnen, dass die Mehrheit der Abgeordneten und der Bürgermeister diesen Beschluss unterstützen werden. Jedenfalls betonten mehrere Abgeordnete während der Debatte, dass sie trotz ihrer Nein-Stimme in der Stadtverordnetenversammlung anerkennen, dass Senftenberg traditionell zum Siedlungsgebiet gehört. Einige würdigten auch die aktuellen Aktivitäten ihrer wendischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Insgesamt war es jedoch beschämend, wie wenig gerade diese Bemühungen Anerkennung fanden. Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE Wolf-Peter Hannig betont völlig zu Recht, dass eine intensive Förderung des Sorbischen/Wendischen in der Stadt allein schon aus moralischen Gründen auf der Tagesordnung stünde, weil in der Vergangenheit durch politische Systeme und den Bergbau diese Kultur regelrecht überrollt wurde.
Für die anwesenden Sorben/Wenden waren solche Beiträge ermutigende Signale, jedoch war es insgesamt deprimierend, wieder einmal als Objekte der Begutachtung durch teilweise höchst inkompetente Lokalpolitiker ohne Möglichkeit der Erwiderung lediglich einem Spektakel beizuwohnen, das nicht frei von diskriminierenden und paternalistischen Momenten war.
Förderung und Ermutigung oder wenigstens Neugierde oder meinetwegen bloß die Hoffnung, dass sich sorbische/wendische Kultur touristisch vermarkten ließe, kamen nicht zum Tragen. Man kann nur hoffen, dass sich die Sorben/Wenden der Stadt jetzt nicht entmutigt oder genervt zurückziehen. Es wäre schade, wenn alle bisher erfolgreichen Bemühungen umsonst wären. Es wäre schade, wenn viele Einwohnerinnen und Einwohner nicht einmal erfahren würden, was ihnen ohne Bewahrung und Pflege der sorbischen/wendischen Kultur entgeht. Schließlich ist hier zu lernen, wie wertvoll der gleichzeitige Umgang mit mehreren Kulturen sein kann.
Interkulturelle Kompetenz heißt das Prinzip, dass es zu fördern gilt. Nicht der Antrag spaltet oder schadet der Stadt, wie einige Abgeordnete meinten, sondern das provinzielle Gehabe einiger der lokalen Volksvertreter.
Eine Aufgabe bleibt natürlich, nämlich dafür zu sorgen, dass der Wert des Sorbischen/Wendischen für Senftenberg sinnlich erlebbar für möglichst viele wird. Diese Aufgabe kann die Minderheit nicht alleine bewältigen.
Zły Komorow: Warum Senftenberg zum angestammten sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet gehört
Eine Argumentation
Gehört Zły Komorow/Senftenberg zum angestammten sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet? Unter historischen und kulturellen Gesichtspunkten ist diese Frage recht deutlich zu beantworten: Ja, die Stadt wie das Umfeld gehören dazu.
Das neue Standardwerk „Sorbisches Kulturlexikon“ [i] belegt unter dem Stichwort „Senftenberger Region“ für ein Lexikon erstaunlich umfangreich, dass Zły Komorow/Senftenberg zum sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet gehört und es eigentlich nur darum geht, diese Tatsache auch offiziell anzuerkennen. Auch mein Artikel im sorbischen Kulturmagazin „Rozhlad“ [ii], wenn auch aus aktuellem Anlass teilweise zu polemisch geraten, liefert Fakten zur Beantwortung dieser Frage.
Daraus zu schlussfolgern, dass der Antrag auf Zugehörigkeit der Stadt zum sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet nur noch eine formale Angelegenheit sei, wäre jedoch ein fataler Fehler. Denn wenn auch nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen Zły Komorow eindeutig dem sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet zuzuordnen ist, so ist damit noch lange nicht geklärt, wie durch einen formal richtigen Beschluss Senftenberg tatsächlich mit sorbischer/wendischer Kultur und Tradition beseelt werden kann und von den Einwohnerinnen und Einwohnern auch als Zły Komorow wahrgenommen wird. Es geht um mindestens drei Fragen, die beantwortet werden müssen bzw. wenigstens in eine durch Offenheit und Streben nach Erkenntnisgewinn gekennzeichnete Debatte geholt werden sollten, um das Sorbische/Wendische in der Stadt und im Umfeld mit Leben zu erfüllen.
Angestammtes Siedlungsgebiet
Erfüllt Zły Komorow/Senftenberg die im novellierten Sorben/Wenden-Gesetz genannten Kriterien, um offiziell als Bestandteil des Siedlungsgebietes geführt zu werden?
Da es um die Umsetzung gesetzlich festgelegter Rechte der Sorben/Wenden geht, die auf verfassungsrechtlicher Grundlage beruhen, muss selbstverständlich die erste zu beantwortende Frage so formal gestellt werden.
Die Gemeinden und Gemeindeteile, die zum angestammten Siedlungsgebiet gehören, sind in der Anlage zum 2014 novellierten „Sorben/Wenden-Gesetz“ aufgelistet. [iii] Hier findet sich Zły Komorow (noch) nicht. Darüber hinaus definiert jedoch der Paragraph 3 im Absatz 2 das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden wie folgt:
„Als angestammtes Siedlungsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gelten die kreisfreie Stadt Cottbus/Chóśebuz sowie diejenigen Gemeinden und Gemeindeteile in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa, in denen eine kontinuierliche sprachliche oder kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweisbar ist.“ [iv]
Eine sprachliche Tradition ist lediglich rudimentär nachweisbar. Das ist nicht verwunderlich, wenn berücksichtigt wird, dass durch die Monoindustrie auf der Grundlage einer extensiven Braunkohleförderung die autochthone sorbische/wendische Bevölkerung in den letzten über einhundert Jahren von zugezogenen deutschen Arbeitskräften immer mehr verdrängt wurde, nicht zuletzt auch durch die bergbaubedingte Vernichtung sorbischer/wendischer Dörfer und Ortsteile in und um Senftenberg. Viel mehr grenzt es an ein Wunder, dass trotz dieser Entwicklung und der Unterdrückung der Sorben/Wenden durch die Nazis kulturelle Traditionen sich in beachtlicher Weise erhalten haben. Sorbische/wendische Bräuche sind weitgehend bekannt und wurden und werden faktisch ohne Unterbrechung gepflegt (Osterbräuche, Vogelhochzeit, Maibaumaufstellen usw.) Flurnamen und Familiennamen belegen die slawischen Wurzeln der Bevölkerung. Zahlreiche kulturelle und politische Veranstaltungen zu sorbischen/wendischen Themen sowie regelmäßig stattfindende deutsch-wendische Gottesdienste werden mit Interesse auch von der deutschen Bevölkerung besucht. Die Wendische Kirche erweist sich als kulturelles Zentrum dieser lebendigen Traditionen. Ausstellungen und Programme im Theater NEUE BÜHNE, nicht zuletzt auch die hier immer wieder tätigen sorbischen Schauspielerinnen und Schauspieler und die Kooperation mit dem Deutsch-Sorbischen Volkstheater und dem Sorbischen Nationalensemble Bautzen, belegen eine enge Bindung an sorbische/wendische Traditionen. Sprachkurse, inzwischen nicht nur für Anfänger, und eine aktive Domowina-Gruppe sind weitere Indizien dafür, dass die formalen Kriterien einer Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet erfüllt sind.
Allein die positive Beantwortung dieser Frage rechtfertigt die offizielle Aufnahme der Stadt Zły Komorow/Senftenberg in die Liste der Gemeinden und Gemeindeteile des angestammten sorbischen/wendischen Siedlungsgebietes im Land Brandenburg. Formal wäre damit alles geklärt. Ein lebendiges sorbisches/wendisches Leben und die tatsächliche Anerkennung der Stadt als Ort der zwei Kulturen bei der Bevölkerung muss damit jedoch noch lange nicht erreicht sein.
Antworten auf mindestens zwei weitere Fragen sollten deshalb ernsthaft gesucht werden.
Die Frage nach dem Subjekt des Sorbischen/Wendischen
Gibt es überhaupt Träger einer sorbischen/wendischen Kultur und/oder Sprache in der Stadt?
So heißt die zweite Frage. Auch diese Frage kann eindeutig positiv beantwortet werden. Denn eine aktive Domowina-Gruppe, die inzwischen auch Ansprechpartnerin für Fraktionen und Verwaltung ist, zahlreiche Pressebeiträge sowie der Veranstaltungskalender der Stadt, wendisch-deutsche Gottesdienste sowie u.a. auch die kulturpolitische Bildungsarbeit des Lausitzbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung belegen, dass hier Sorben/Wenden aktiv tätig sind. Die Beteiligung in Senftenberg an der Wahl des Sorben/Wenden-Rates 2015, an der alle Sorben/Wenden teilnehmen konnten, die sich in das Wahlverzeichnis eintragen ließen, und die rege öffentliche Diskussion über diese Wahl sind ein weiterer Beweis dafür, dass es Sorben/Wenden auch heute in der Stadt gibt.
Immer wieder wurde jedoch auch nach Zahlen gefragt, um feststellen zu können, ob der ganze Aufwand, Senftenberg ins sorbische/wendische Siedlungsgebiet aufzunehmen, sich denn überhaupt lohnen würde. Hier bekommen wir es mit dem Problem zu tun, dass aus guten Gründen nach den Erfahrungen mit der Verfolgung der Sorben/Wenden durch die Nazis eine Quantifizierung in einzelnen Orten oder gar eine namentliche Erfassung nicht zulässig ist. Aber auch der starke Assimilierungsdruck auf Sorben/Wenden hat zu einer demokratietheoretisch sehr modernen Formulierung im brandenburgischen „Sorben/Wenden-Gesetz“ geführt.
Der Paragraph 2 „Sorbische/Wendische Volkszugehörigkeit“ legt fest: „Zum sorbischen/wendischen Volk gehört, wer sich zu ihm bekennt. Das Bekenntnis ist frei und darf weder bestritten noch nachgeprüft werden. Aus diesem Bekenntnis dürfen der Bürgerin und dem Bürger keine Nachteile erwachsen.“ [v]
Außerdem greift hier ein Verfassungsgrundsatz verbindlich. Denn in der brandenburgischen Verfassung ist im Artikel 25 „Rechte der Sorben/Wenden“ nicht nur das „Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes“ [vi] vorgesehen.
Ausdrücklich ist „das Recht auf Bewahrung und Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur im öffentlichen Leben und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten“ [vii] festgelegt. Wenn es auch nicht gelungen ist, im Gesetz die „Weiterentwicklung der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache“ zu verankern, die Formulierung „Förderung“ dürfte deutlich genug festlegen, dass Sorben/Wenden sich nicht wie Ausstellungsstücke im Museum bewegen müssen, um ihre Rechte zu fordern, sondern selbstverständlich Veränderungen – Weiterentwicklungen – gewünscht sind.
Betont werden sollte unbedingt, dass die Sorben/Wenden in der Verfassung als Volk definiert werden. Dazu passt unter Beachtung internationaler Debatten in der Wissenschaft nicht ganz, dass wir im offiziellen Sprachgebrauch noch immer von „Minderheitenpolitik“ reden. Die praktisch-politischen Konsequenzen dieses Herangehens sind allerdings unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen als überwiegend positiv einzuschätzen.
Kulturelles und politisches Klima
Existiert in der Stadt und im Umfeld ein kulturelles und politisches Klima, in dem ein lebendiges sorbisches/wendisches Leben als wünschenswert betrachtet wird?
Das ist die dritte Frage, die schwierigste von allen. Denn diese Frage beschreibt eine nicht durch Mehrheitsbeschluss zu lösende Aufgabe. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht.
Je nachdem wie sie beantwortet wird bzw. wie sie aufgegriffen wird, davon hängt ab, ob das Sorbische/Wendische mit Leben erfüllt werden kann – zum Nutzen auch für die Mehrheitsbevölkerung. Ein formaler Beschluss und Kenntnis der rechtlichen Grundlagen sind zwar Voraussetzungen für alles Weitere, was noch zu leisten ist, um einer Antwort näher zu kommen, müssen jedoch noch lange nicht dazu führen, dass für viele Bürgerinnen und Bürger sinnlich erlebbar wird, dass das Sorbische die Region attraktiver macht. [viii] Einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der rechtlichen Grundlagen hat Renate Harcke, Referentin der brandenburgischen Landtagsfraktion DIE LINKE, mit ihrer Handreichung zum „Sorben/Wenden-Gesetz“ gelegt. Diese sei ausdrücklich empfohlen. [ix]
Wenn eine Kernfrage der Minderheitenpolitik nicht verstanden wird, dass nämlich eine Minderheit als Subjekt politischer Willensbildung nicht überstimmt werden kann, dann wird es äußerst schwierig, ein lebendiges sorbisches/wendisches Leben zu entwickeln. Hier wird kulturelle Bildung in der Stadt gefragt sein, die das Sorbische/Wendische als Gewinn erlebbar werden lässt. Als wesentliches Merkmal demokratischer Minderheitenpolitik kann Verzicht auf Paternalismus im Umgang mit Sorben/Wenden genannt werden. Es geht, wie bereits gesagt, auch darum, Traditionen zwar zu bewahren und wiederzubeleben, gleichzeitig darüber hinaus Veränderungen zuzulassen. Ein solcher Prozess kann nur im Dialog mit der Mehrheitsbevölkerung, bei gegenseitiger Bereicherung beider Seiten, in Gang gesetzt werden.
Ein Blick in andere Regionen, die eine bewusste Minderheitenförderung betreiben, ließe einige Vorteile sichtbar werden. Regionale Kreisläufe in der Wirtschaft, touristische Attraktivität und gelebte Offenheit gegenüber ursprünglich Fremden sind hier u.a. die Stichworte. In der aktuellen Minderheitenpolitik geht es um das Bewahren und Fördern der kulturellen Vielfalt auch deshalb, weil diese als hoher Wert in einer globalisierten Welt angesehen werden, nicht als nostalgisches Bewahren des Vergangenen.
Aktive Minderheitenpolitik kann so ein Standortvorteil für die Stadt sein.
Die Frage nach dem Wert sorbischer/wendischer Sprache und Kultur und moderner Minderheitenpolitik weist über das enge Thema „Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet“ weit hinaus, weil allein eine gründliche Befassung politisch-praktische und theoretische Konsequenzen hat, die von allgemeiner Bedeutung für die Zivilgesellschaft, die demokratische Verfasstheit des Landes und das allgemeine politische Klima für die Region sind. Das zu erkennen, das muss eingeräumt werden, ist ein komplizierter Prozess. [x]
Weiterhin geht es um eine spezielle Stärkung der Demokratie, wenn im Umgang mit Minderheiten das Mehrheitsprinzip bei Entscheidungen außer Kraft gesetzt wird, also durch „positive Diskriminierung“ Belange der Sorben/Wenden nicht maßgeblich und schon gar nicht gegen die Betroffenen durch die deutsche Mehrheitsbevölkerung entschieden werden dürfen. Das ist der eigentlichen Kern der Minderheitenpolitik, die Krone der Demokratie, wenn das demokratische Mehrheitsprinzip an dieser Stelle demokratisch außer Kraft gesetzt wird.
Dass dadurch Solidarität und Toleranz befördert werden können, das dürfte auf der Hand liegen.
ANMERKUNGEN
- i Vgl.: Franz Schön / Dietrich Scholz (Hrsg.). Sorbisches Kulturlexikon. Bautzen 2014. S. 357ff.
- ii Vgl.: Gerd-Rüdiger Hoffmann: „Kulturne wójowanje“ - Źěło na nowej serbskej kazni za Bramborsku. In: Rozhlad. Nr. 10/2013. S. 7ff. – auf deutsch: „Kulturkampf?“- Über die Arbeit am neuen Sorben/Wenden-Gesetz in Brandenburg
- iii Vgl.: Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (Sorben/Wenden-Gesetz - SWG) vom 7. Juli 1994 (GVBl. I/94, [Nr. 21], S.294), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Februar 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 07])
- iv Ebenda: § 3 (2)
- v Ebenda: § 2
- vi Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 (GVBl.I/92, S.298) zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 42]), Artikel 25, Absatz 1
- vii Ebenda: Artikel 25, Absatz 3
- viii Vgl.: Lausitzer Rundschau vom 27. November 2015
- ix Vgl.: Renate Harcke. Kleines A – Z zum Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg. Potsdam 2014 (siehe: www.swg-brandenburg.de)
- x Vgl.: Gerd-Rüdiger Hoffmann. Das Recht auf Anderssein. Philosophische und praktisch-politische Überlegungen zur Sorben/Wenden-Politik in Brandenburg. In: Daniel Häfner / Lutz Laschewski (Hrsg.). Recht auf Perspektive. Cottbus (BTU Cottbus-Senftenberg / Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg) 2015. S. 19ff.
"Manifestliches" im Theater am Rand
Beitrag in der Zeitschrift "Das Blättchen" [18. Jg. (2015) Nr. 21]
von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
Wer den „Tag der deutschen Einheit“ nicht im Taumel des Offiziellen begehen, dennoch diesen Tag nicht ignorieren wollte, der konnte durchaus fündig werden. Nach dem Motto eines Wenzel-Liedes „Halte Dich von den Siegern fern, / Halte Dich tapfer am Rand!“ war das Theater am Rand im Oderbruch eine gute Adresse. Hier spielte bereits am Vorabend die „Bolschewistische Kurkapelle“ und ließ das voll besetzte Theater mit Eisler, Reiser und Brecht beben.
Am Feiertag dann eine Premiere: Der Schauspieler Jens-Uwe Bogadke, Tobias Morgenstern am Akkordeon, der legendäre Conny Bauer an der Posaune sowie vor allem Walfriede Schmitt präsentierten eine Collage aus Marx-Texten und geschickt ausgesuchten Stellen aus dem 1920 zu erst erschienenen fiktiven Reisebericht „Der Papalagi“ von Erich Scheurmann. Das Buch zu „Manifestliches – Dialog zwischen Karl Marx und dem Südseehäuptling Tujavii“ schrieb Walfriede Schmitt selbst. Regie führte Olaf Winkler. Gern konnte man deshalb der Ankündigung glauben, dass die Namen der Mitwirkenden für Sinnlichkeit und Humor bürgten. Und wer das von Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann geleitete Theater am Rand einmal gefunden hat, weiß ohnehin, dass Denken nicht notwendigerweise schlimm sein muss. Unterstützt haben das Vorhaben die kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Sigrid Hupach, Hans Modrow und die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Dennoch gab es vor der Aufführung gute Gründe für eine gewisse Skepsis. Einmal wurde mit brechtscher didaktischer Strenge im Programmheft angekündigt, dass es Zeit sei, mit dem Jammern auf hohem Niveau aufzuhören. Aufklärung darüber sei angesagt, dass das Kapital dabei wäre, die alleinige Herrschaft in der Welt endgültig zu erringen und dass es deshalb höchste Zeit sei, „konzentriert hinzuschauen auf die beängstigenden Gründe für den Zustand dieser Welt“.
Doch gehören Sätze aus dem „Kommunistischen Manifest“ oder dem „Kapital“ wirklich auf die Bühne, und können sie zu neuen Erkenntnissen über unsere Zeit führen? Kann das gar unterhaltsam sein? Bei diesem Publikum, zum großen Teil aus Berlin angereist mit einem von der Luxemburgstiftung gecharterten Bus? Kommt da nicht bloß Bestätigung des immer schon Gewussten raus?
Ja, das auch, und an einigen Stellen gab es selbst dafür Szenenapplaus, weil die Wut der Akteure auf der Bühne über den Zustand der Gesellschaft echt war. Berührend und gleichzeitig von eindringlicher Schärfe zum Beispiel der verzweifelte Aufschrei der Schmitt in Richtung Linke: „So einigt Euch doch!“
Dass ein tieferes Nachdenken nützlich ist, dass Marx noch immer dabei behilflich sein kann, dass schließlich Wut alleine nicht ausreicht, sondern zu „wissender Unzufriedenheit“ führen müsse, wie Ernst Bloch es formulierte, das alles wurde sinnlich wahrnehmbar. Selbst schwierige Texte belehrten mit einem Augenzwinkern äußerst kurzweilig. Man war an Yanis Varoufakis erinnert, der sich zwar als erratischer Marxist bezeichnet und Marx deshalb mit flotter Polemik immer wieder mal vom Sockel holt, aber auch betont: „Jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster sehe, bin ich mit den Widersprüchen konfrontiert, auf die er hingewiesen hat.“
Walfriede Schmitt gibt den „Kapitalisten an sich“ mit allen Klischees, die man von Karikaturen der 1920er Jahre kennt. Der kluge Humor der Buchautorin und das intensive Spiel der Schauspielerin in einer Person vermeiden aber jede Plattheit. Und wenn es dann doch im Text zu akademisch wird, geht die Musik dazwischen. Das hat Witz, wenn gewaltige Marx-Sätze durch Posaune und Akkordeon gelegentlich regelrecht karikiert werden. Das kann der Marx doch nicht ernst gemeint haben! Und wenn doch, dann ist unverständlich, warum alles anders gelaufen ist.
Der erste Grund für Skepsis ist also entkräftet, und so erging es auch dem anderen, obwohl der schwerer wiegt.
Der zweite Grund liegt nämlich in der Verwendung der „Reden des Südseehäuptlings Tujavii aus Tiavea“, angeblich gehalten vor seinen Leuten, nachdem er aus Europa zurückgekehrt ist und gar seltsame Dinge über das Denken und Tun des Weißen, des Papalagi, zu berichten hat: Geld sei bei ihm Gott. Selbst Liebe ginge beim Papalagi nicht ohne Geld. Ständig wolle er Dinge, nur durch eine Anhäufung von vielen Dingen fühle er sich in seinem Wert bestätigt. Zeit hätte er nie.
Die Textstellen sind so ausgewählt, dass der romantisierende Ethnokitsch Scheurmanns nicht zum Tragen kommt. Jens-Uwe Bogadke spielt den „Häuptling“, den Retter der Bäume, Tiere und des Menschlichen, als Überlegenen gegenüber dem satten und zum Schluss dann doch ermatteten und verunsicherten Kapitalisten.
Und die musikalischen Einfälle von Conny Bauer und Tobias Morgenstern machen die Sache rund und retten manchmal auch die Grundidee. Denn Walfriede Schmitt geht es vor allem darum zu zeigen, dass so manches Ungerechte und Unbegreifliche durch recht alte Wahrheiten des gesunden Menschenverstandes und nach dem Lesen von Marx-Büchern umso mehr durchschaubar sein müssten. Gleichzeitig, und hier spielt wieder die Musik eine tragende aufklärerische Rolle, sei es besser, auch die einfachen Wahrheiten immer wieder neu zu prüfen.
Scheurmann tat zeitlebens so, als hätte er den „Häuptling“ Tujavii gekannt und lediglich seine Botschaft übersetzt. Beim Schummeln erwischt und von kritischen Ethnologen angegriffen, verteidigten er und seine Anhänger das Machwerk bierernst und stur. In „Manifestliches“ zerstören die Musiker Conny Bauer und Tobias Morgenstern und Jens-Uwe Bogadke mit herrlicher Ironie alles Apodiktische, wodurch das kapitalismuskritische Anliegen des Theaterstücks stärker hervortritt.
Damit ist auch die Abgrenzung zum später naziaffinen Scheurmann gelungen, der außerdem noch üble Beiträge über exotische Frauen und andere Geschichten über „die edlen Wilden“ verfasst hat. Was Marx zur „Agrikultur“ im „Kapital“ formulierte, wurde im Theater am Rand zu guter aufklärerischer Unterhaltung: Die Tragik des Kapitalismus mit seiner nicht zu bremsenden Dynamik in der Produktion bestünde darin, dass „sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter“. Die Frage, ob diese Feststellung Widerstand mobilisiert oder ob das Sich-Fügen unter die Geschäftsordnung des Systems weiterhin dominieren wird, bleibt offen. „Manifestliches“ trifft auf die Wirklichkeit.
Einige „Striche“ würden der Collage nicht schaden, dann jedoch sollte unbedingt nach weiteren Aufführungsmöglichkeiten gesucht werden.
Hier geht es zum Beitrag auf der Homepage des Blättchens ...
Entdeckung eines Bekannten. "Sterne glühn" - Hans-Eckardt Wenzel hat Gedichte von Johannes R. Becher vertont
Beitrag in der Zeitung "neues deutschland" (Kultur)
von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
Johannes R. Becher schaffte es wie kaum ein anderer die Widersprüche des 20. Jahrhunderts mit seinen Hoffnungen und Enttäuschungen, Wahrheiten und Lügen in Gedichtform auszudrücken. Der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel hat einige der Gedichte vertont.
Im Roman »Abschied« von Johannes R. Becher (1891-1958) gibt es eine Stelle, wo der Ich-Erzähler »das Jüdlein« um Rat fragt, weil er nicht mehr weiter weiß. Das Alter Ego des Johannes R. Becher, Hans Peter Gastl, offenbart seinem Klassenkameraden Löwenstein, »dem Jüdlein«, folgendes: »Ich kann nicht weiterleben so. Ich will nicht mehr. In welch eine Zeit bin ich geraten! Strammstehen, nur strammstehen. Vor anderer Leute Gemeinheiten und vor der eigenen Gemeinheit. Nein - ich bin allein zu schwach, um standzuhalten. Dazu reicht meine Kraft nicht. Inmitten einer großen Lüge lebte ich, und geschickt fängt es die Lüge an, wenn ich versuche, aus ihr herauszufinden, mich immer tiefer in sie zu verstricken ... Du, sag mir, an was man sich halten kann?« Und das »Jüdlein« erklärt ihm Klassenkampf, Sozialismus und eben die Hoffnung auf »Die - menschliche - Gesellschaft«.
»Abschied« hatte Becher unter dem Eindruck kaum aushaltbarer Konflikte im Persönlichen wie im Politischen 1940 im Moskauer Exil fertiggestellt, allerdings mit einer kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges vorverlegten Handlung, schwankend zwischen Selbstmord und der großen Hoffnung auf das »Anderswerden«. 1940 steht Becher der weitere Selbstmordversuch in Moskau noch bevor, den er kurz nach dem Misslingen in einem reumütigen Brief an das Zentralkomitee der KPD vom 16. September 1942 zutiefst bedauert und versichert, »daß sich ein derartiger Fall nicht mehr wiederholen wird«. Mit der Sache des Kommunismus habe diese unbedachte Handlungsweise nichts zu tun, versucht Becher in seinem Brief deutlich zu machen: »Ich spüre die Kraft in mir, alle Aufgaben, die mir der Kampf und die Partei stellt, zu erfüllen.«
Bei Johannes R. Becher war es immer wieder dieser Glaube an »die Kraft des Kommunismus, in der Kritik des Scheins Glauben ohne Lüge freizumachen«, wie es ein so kritischer Kopf wie Ernst Bloch in »Das Prinzip Hoffnung« formulierte und auch für sich selber reklamierte. Das »Anderswerden« ist zeitlebens das beherrschende Thema bei Becher. Wie aus dem Erlebten neue Erkenntnis formuliert und zur Tat gebracht werden sollte, das wollte er für sich und andere erklären, immer wieder auch in seinen zahlreichen Gedichten.
Mit harmonischen Akkorden sei das jedoch nicht zu leisten: »Der Dichter meidet strahlende Akkorde. / Er stößt durch Tuben, peitscht die Trommel schrill. / ... / O Trinität des Werks: Erlebnis Formulierung Tat. / ... / Der neue, der Heilige Staat / ... / Restlos sei er gestaltet. / ...«, so kommt er uns in seinem Gedicht »Vorbereitung«, das in einem der wichtigsten Zeugnisse des Expressionismus, nämlich in dem Band »Menschheitsdämmerung« aus dem Jahre 1919, veröffentlicht wurde.
Doch es bleibt stets ein Rest. Das bleibt auch so, als Becher im Sonett mit fast Hegelscher Strenge die Form für sein Anliegen gefunden zu haben glaubt - Lösung von Widersprüchen auf jeweils höherer Stufe.
Vielleicht war es dieser auch bei der Person Becher nicht erklärbare Rest, warum wir als Philosophiestudenten der 1970er Jahre mit Interesse auch seine Gedichte lasen. Der »Barbarenzug« war dabei: »Ich sah - ich sah sie kommen, die Barbaren! / Sie kamen nicht aus einem Urwald her ...«. Aber auch: »Ich liebe dich, weil du mich hart bewachst. / Ich liebe dich, weil du mich besser machst.« Schließlich lasen wir die in »Sinn und Form« veröffentlichten Aufzeichnungen Bechers mit der Erwartung, Erklärung für Widersprüchliches zu finden. Alles sollte zwar erklärlich sein, ohne Rest, aber eben nicht so langweilig und apodiktisch wie in den Lehrbüchern dieser Jahre.
Warum nun gerade diese »Denkdichtung in Prosa« des expressionistischen und sozialistischen Lyrikers, des staatssozialistischen Gebrauchsdichters, des Verfassers des Romans »Abschied«, des kommunistischen Funktionärs und Antifaschisten und Verfassers der DDR-Nationalhymne Johannes R. Becher das Nachdenken über den Kontrast zwischen offiziellen Verkündigungen und der als sehr unvollkommen empfundenen Gesellschaft beförderte, das ist wohl heute kaum zu verstehen.
Die damalige Wirkung der Texte muss mit der rätselhaften Aura Bechers zu tun gehabt haben, der vielleicht wie kaum ein anderer in einer Person die Widersprüche dieses 20. Jahrhundert mit seinen Hoffnungen und Enttäuschungen, neuen Wahrheiten und Lügen, Aufbrüchen und Katastrophen, Unterwerfungen und Widerspenstigkeiten verkörperte. Vielleicht war es auch das Geheimnisvolle, wenn die große, aber auch abstrakte, Aufgabe »Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt« von einer so zerrissenen Persönlichkeit wie Becher gedichtet wurde. Vielleicht geht richtiges Leben so, dass es immer auch mit dem falschen zu tun bekommt.
Und noch ein Vielleicht: Letzteres spielte vielleicht bei Hans-Eckhardt Wenzel (geb. 1955) eine Rolle, der jetzt eine neue Platte mit von ihm vertonten Gedichten unter dem Titel »Sterne glühn - Wenzel singt Johannes R. Becher« herausbrachte. Fast möchte man ausrufen, dass auf eine solche Idee bloß Wenzel kommen kann. Und: Nur gut, dass er diese Idee hatte und von 2006 bis 2015 insgesamt dreizehn Lieder mit Thommy Krawallo und Hannes Scheffler sowie Stefan Dohanetz produzierte.
Wenzels Kompositionen gehen ins Ohr, berühren und verstören gelegentlich. Sie regen an. Ob die Musik nun zum »Barbarenzug« regelrecht dröhnt und rockt oder »Ich liebe dich« anrührend vertont ist, Wenzels Kompositionen finden zu einer Symbiose mit der Wortgewalt von Becher, in der sich pralles Leben und Verunsicherung ausdrücken. Und dann auch diese irren Texte wie »Gott suchend oder verschlungene Wege« und »Kino«, die Wenzel zu Collagen verdichtet hat. Das sind übrigens Texte, von denen sich Becher zuerst distanzierte und im Alter bemerkte, dass sie doch bleiben sollten und die von ihm »entwickelte tiefsinnige Korrektur-Ideologie« nichts mit einer »Art der Selbstkritik und eine Arbeit an sich selber« zu tun hatte.
Einige propagandistische Zeitgeistgedichte hätte er besser nicht schreiben sollen, wie er selber immer wieder einmal in seinen Aufzeichnungen eingestand. Keinen Kulturminister auf dem Sockel, aber auch keinen ins Gestern Verdammten finden wir auf der CD.
Nicht viel vom Vielschreiber Becher passt auf eine Platte, aber diese Wenzel-Becher-CD macht neugierig auf den ganzen Johannes R. Becher. Am Resultat kaum zu merken, welche intellektuelle Anstrengung dahinterstecken muss. Denn Becher auf diese Art, mit hohem Unterhaltungswert, ins Heute zu holen, darf wohl nicht als die leichteste Aufgabe angesehen werden. Wenzel kann das. Wenzel ist Theoretiker. Wenzel ist der lebende Beweis dafür, dass »Theorie« kein Schimpfwort sein muss.
Man kann es auch so sagen: Erst wer Marx, Hegel und Kant verstanden hat, Bloch und Benjamin auch mal dagegensetzt, kann sich von schwerfälliger Sprache der Welterklärer lösen und mit klugen eigenen und fremden Texten trotzdem Klärendes zur Lage in der Welt beitragen und dabei noch gut unterhalten.
Die theoretische Vorarbeit ist unbemerkt, aber nur durch sie, da bin ich mir sicher, konnte diese neue, wieder einmal eine ganz andere, ausgezeichnete Wenzel-Platte entstehen. So wie Wenzel hier mit Becher kommt, ist der Eindruck wohl nicht falsch, dass manche Texte auch von ihm sein könnten. Wir kennen dieses Gefühl bereits, wenn Wenzel in Konzerten neben eigenen Texten auch solche von Theodor Kramer, Christoph Hein oder Woody Guthrie bringt.
Wenn von einer rundum gelungenen Platte gesprochen werden kann, dann muss unbedingt noch die Hülle erwähnt werden. Diesmal kein Johannes Heisig (geb. 1953) auf der Wenzel-Platte, sondern ein frühes Werk des Malers Hubertus Giebe (geb. 1953) mit diesem damals im Westen und heute vielleicht überall seltsam anmutenden Realismus. Zu sehen ist ein Weg zwischen Mauern, der nicht bloß die Richtung vorgibt, sondern auch noch am Ende des Weges abzuheben scheint über die Mauern hinaus zu einem disparaten Licht hin. »Sterne unendliches Glühen«? - Mit diesem Bild von Giebe, »Die Kaserne (Weg mit Feuermauer)« aus dem Jahre 1974, kommt noch einmal zusammen, was vermeintlich nicht zusammenpasst: das Nebeneinander von Ungleichem - das Bild, das Gedicht, der Text und die Musik auf der einen Seite und dann die Wirklichkeit und ihre Geschichte auf der anderen. Und dann passt es genau deshalb, weil so das Leben ist.
Und so folgt nach dem intimen Stück »Vielleicht« mit Wenzel am Piano der musikalische Kontrast mit dem späten Becher-Gedicht »Turm von Babel«, in dem die Aktualität des immerhin über sechzig Jahre alten Textes regelrecht eingehämmert wird.
»Sterne glühn - Wenzel singt Becher«, dieses Ergebnis der Verbindung Wenzel, Becher und Giebe, ist jedenfalls sehr zu empfehlen.
»Sterne glühn. Wenzel singt Johannes R. Becher« (Matrosenblau)
Das Theater im Revier und Heinz Klevenow
Beitrag in der Zeitschrift "Das Blättchen" [18. Jg. (2015) Nr. 20]
von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
Wer über Heinz Klevenow etwas sagen will, muss über Theater reden. „Wege übers Land“ nennt der renommierte Theaterkritiker Hartmut Krug sein Ende August 2015 aus Anlass des 75. Geburtstages des Schauspielers, Regisseurs und Intendanten Klevenow im Verlag Theater der Zeit erschienenes Buch.
Heinz Klevenow, am 28. August 1940 als Sohn der Schauspielerin Marga Legal (1908-2001) und des Schauspielers, Regisseurs und Intendanten Heinz Klevenow (1908-1975) in Prag geboren, kommt über Umwege zum Beruf des Schauspielers. Sein erstes Engagement führt ihn nach Weimar, wo großes Theater und Provinzialität auf sehr spezifische Weise aufeinandertreffen. Es folgen Stendal, Senftenberg und Halle, dann Leitungsfunktionen in Halle (am Puppentheater), Rudolstadt und Rostock. Schließlich wird Klevenow 1989 Intendant am Theater in Senftenberg, das zu dieser Zeit noch Theater der Bergarbeiter heißt. Und obwohl er bis zu dieser Zeit bereits einen Namen hat, heute ist der Name Klevenow vor allem mit der Rettung der NEUEN BÜHNE Senftenberg verbunden.
Seit der Gründung im Oktober 1946 ging es in Senftenberg, auf Niedersorbisch Zły Komorow, was aber zuerst durch die Nazis und dann durch Bergbau und Industrialisierung mehr und mehr verdrängt wird, immer wieder um das Weiterleben des Theaters. In der Provinz macht das viel Arbeit, denn hier ist gutes Theater nicht automatisch berühmtes Theater. Heinz Klevenow kennt die für Fremde seltsame Mentalität der Menschen im Revier und lässt sich darauf ein, für diese Theater zu machen. Der Spruch auf den Plakaten „Ich bin Bergmann, wer ist mehr!“ wurde von vielen gelebt, war ernst gemeint. Dann das Ende des Bergbaus. Doch ein Theater, das nicht mit Umbrüchen und Unberechenbarem zu tun bekommt und dieses meistert, ist vielleicht nicht so lebendig und vor allem nicht so langlebig wie das Theater Senftenberg.
Gegründet im Oktober 1946 „auf Befehl“ von Oberst Iwan D. Soldatow in einer Zeit des Hungerns, der Ungewissheit, aber auch der großen Hoffnung, dass die Menschen doch wieder zur Vernunft kommen mögen, waren es dann in der Geschichte des Hauses immer wieder neu zu schaffende Voraussetzungen für gutes Theater. Lediglich drei sollen genannt werden.
Erstens: Zuerst muss Theater gewollt sein. Theater braucht Publikum. Jedoch, hätte sich das Senftenberger Theater bloß nach Geschmack und Quote gerichtet, der 75. Geburtstag von Heinz Klevenow könnte nicht im Theater gefeiert werden. Andererseits kann und soll Publikum den kulturpolitischen Kassenwarten und ideologischen Kunstwächtern auch Angst machen, wenn sie mit „veränderten Erwartungen“, „wachsendem Legitimationsdruck“ und dem „demografischen Faktor“ drohend Finanzen kürzen wollen. Mit dieser komplizierten Dialektik umzugehen, das will erst einmal geschafft sein. Heinz Klevenow hat das geschafft.
Dabei ist in diesem Fall mit „Dialektik“ völlig unhegelianisch und unmarxistisch die Kunst gemeint, immer wieder auf die Füße zu fallen. Anders gesagt, man muss schlau sein, nicht bloß gebildet, um ein Theater über die „Wende“ zu bringen und dann immer wieder mal konzeptionelle Überlegungen der Kulturbürokratie zur „Neuordnung der Theaterlandschaft“ im Lande abprallen zu lassen. Dass Klevenow das hinbekommt, war frühzeitig klar, nämlich als er den Termin für die Neueröffnung nach dem Umbau des Theaters auf den 16. Oktober 1990 trickste, um nicht mit dem ausgemusterten „7. Oktober“ oder dem garantiert vorher zu veranstaltenden „Tag der deutschen Einheit“ zu kollidieren. Glück gehört natürlich auch dazu, wenn Theater gegründet oder in eine neue Gesellschaft gehoben werden. Gardeoberst Iwan D. Soldatow war ein solcher Glücksfall. Christoph Hein würdigte zum Theaterjubiläum 2006 die Eröffnung des Senftenberger Theaters durch ihn als „eine bewundernswerte Großtat, die uns verpflichtet“.
Ja, es soll deshalb gelten: Ein in Hungerzeiten gegründetes Theater schließt man nicht in Zeiten des Überflusses.
Zweitens: Weiterhin müssen Künstlerinnen und Künstler da sein, die Theaterspielen können, genau dieses Theater an diesem Ort wollen und dann auch noch von dieser Arbeit leben können. Klevenow als Faust und Mephisto, als Nathan, als Richter Adam in „Der zerbrochene Krug“ oder auch als Campingplatzwart in einem irren Sommerstück fürs Amphitheater und in vielen anderen Rollen – Heinz Klevenow ist gut. In heutiger Zeit, in der das Wort großer Schauspieler fast nur noch in Verbindung mit roten Teppichen, Blitzlichtgewittern und Sternchen im Boden weit entfernter Fußgängerzonen genannt wird, muss man es betonen: Heinz Klevenow war nicht nur Theaterintendant in Senftenberg, er ist ein großer Schauspieler.
Spätestens beim Odysseus in der Inszenierung von Karl Gündel war das wohl klar. Und dann Klevenow als Stéphane Hessel mit „Empört Euch!“ in der „Jedermann“- Inszenierung von Sewan Latchinian. Da waren Eigensinn und Empfindsamkeit, das war Klevenow. Theater lebt davon, dass man nicht auf der Couch sitzen bleibt und wegen Klevenow zum Beispiel ein Stück zum zweiten Mal sehen will. Weil Klevenow Künstler ist, weiß er auch, wie eine Ansammlung von Individualisten zu einer kollektiven Höchstleistung zu bringen ist. Klevenow kennt auch genau den Unterschied zwischen Spielstätte und Ensembletheater. Das ist wichtig. Zu vermuten ist, diesen Unterschied zu erklären, wird in nächster Zeit noch wichtiger werden.
Drittens: Schließlich müssen unter Künstlern stets auch solche sein, die über ihre künstlerische Arbeit hinaus es auf sich nehmen, gutes Theater zu organisieren – sich mit den Rahmenbedingungen herumzuschlagen, die eigenen Leute zu motivieren, mit den Kassenwarten und Bürokraten umzugehen und es sich mit Verbündeten und Feingeistern nicht zu verderben. Es geht immer wieder um Herausforderungen im Spannungsverhältnis zwischen „Theater als moralische Anstalt“ und „Marktkonformität“. Klevenow wollte ein Amphitheater – für viele zahlende Gäste.
Sehr energisch setzte er diese Idee durch, die man durchaus als Reaktion auf die Macht des Marktes bezeichnen kann. Mehr jedoch ist das Amphitheater ein Ort für Menschen, die auch im Sommer Theater wollen oder sonst niemals ins Theater gehen.
Und man sollte als Chef eines Theaters wissen, wann Schluss ist. Auch das bekam Heinz Klevenow 2004 hin und besorgte, für einen scheidenden Intendanten ungewöhnlich uneitel, dem neuen Intendanten Sewan Latchinian die besten Bedingungen.
Als Klevenow Intendant wurde, stand die Frage, ob sein Theater mit „wehenden Fahnen als Mehrspartentheater untergehen oder unter einer neuen Struktur weiterleben“ wollte. Weiterleben, das war die Ansage von Klevenow. Das klingt gut und soll so in den Geschichtsbüchern stehen. Doch in Erinnerung ist auch die Lautstärke, mit der Heinz Klevenow mitunter seine Position vertrat. „Feingeistig“ wäre nicht das richtige Wort dafür. Denn Weiterleben hieß ja auch, dass ein ganzes Orchester das Theater verlassen musste. Und so gab es damals in den hitzigen und oft überhaupt nicht sachlichen Diskussionen im Klub der Intelligenz des Kulturbundes nicht bloß Beifall für den Intendanten Klevenow.
Dennoch, Empfindsamkeit und Mitgefühl trotz der Härte, die notwendig ist, um ein Theater unter kapitalistischen Bedingungen in der Provinz am Leben zu halten, sind die Markenzeichen von Heinz Klevenow. Jetzt kommt noch Altersweisheit dazu. Im Theater und im Revier wird das gebraucht. Klevenow bleibt weiterhin Schauspieler an der NEUEN BÜHNE.
Hier geht es zum Beitrag auf der Homepage des Blättchens ...
Wendischer Nachmittag am 22. August in Senftenberg / Zły Komorow
Beitrag von Gerd-Rüdiger Hoffmann für die niedersorbische Zeitung Nowy Casnik
Zły Komorow (Senftenberg), das wissen nicht nur die Leserinnen und Leser dieser Zeitung, hat regelmäßig Bildendes und Unterhaltendes zur Kultur und Geschichte der Sorben/Wenden zu bieten. Dem teilweise heftigen Streit um die Frage, ob Zły Komorow zum sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet zu rechnen sei, ist sicherlich geschuldet, dass es vor allem politische Bildungsveranstaltungen sind, die auf großes Interesse bei der Bevölkerung rund um Zły Komorow treffen. Das Lausitzbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg kann ein Lied davon singen, wenn wieder einmal der Raum für eine geplante Bildungsveranstaltung zu klein war, etwa beim Philosophieabend über die sorbische Intellektuelle Marja Grólmusec. Auch die Veranstaltungen der Cottbuser Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur in der Wendischen Kirche, einschließlich der Niedersorbisch-Sprachkurs, sind stets gut besucht. Die Domowina-Ortsgruppe ist inzwischen eine von der Lokalpolitik ernst genommene Instanz. Um die Teilnehmerzahl beim jährlich stattfindenden deutsch-wendischen Gottesdienst wird so manche Gemeinde im Siedlungsgebiet den Senftenberger Pfarrer Manfred Schwarz beneiden. Es sieht also recht gut aus im Bemühen, die sorbische/wendische Geschichte und Kultur in der Senftenberger Bevölkerung bewusst werden zu lassen und bei den Sorben/Wenden unter ihnen die Sprache zu revitalisieren. Mit der Wendischen Kirche als Symbol und Ort dieser Bemühungen im Zentrum der Stadt sind sehr gute Voraussetzungen gegeben.
Nun jedoch gab es zum wiederholten Mal im Rahmen dieser Anstrengungen von Domowina und Niedersorbischer Sprachschule eine Einladung in die Gaststätte der Gartensparte „Heimatruh“ am Rande der Stadt. Das ist eventuell riskant mit Blick auf Teilnehmerzahlen, aber mehr als eine symbolische Geste und sicher gut so. Die rührige Leiterin der wendischen Cottbuser Bildungseinrichtung Maria Elikowska-Winkler hatte zum ersten wendischen Nachmittag eingeladen, um gemeinsam mit der Tanzgruppe Bährenbrück und der Malerin Evelyn Pielenz Unterhaltsames und Unbekanntes vorzustellen. Unterstützung fanden sie beim Wirt Ralf Lapstich, selbst sorbischer Herkunft. Und so fühlten sich alle beim Zuschauen der Tänze, bei den Erläuterungen zu den unterschiedlichen Trachten und zur Sprache gut unterhalten. Mitmachen konnte man beim Quiz um Ortsnamen sowie beim Malen von wendischen Symbolen und Sagengestalten. Nicht zuletzt wurde Interesse an der Sprache geweckt, weil Maria Elikowska-Winkler, ganz Lehrerin, einige lustige Beispiele vorführte, was passiert, wenn ähnlich geschriebene Wörter durcheinander geraten. Den Unterschied zwischen žiwa und žywa oder zwischen žabys und zabiś werden sich viele nach diesem anregenden Nachmittag wohl merken. Vielleicht bekamen einige Gäste auch Lust auf den Niedersorbisch-Sprachkurs in der Wendischen Kirche. Schließlich wurde auch gemeinsam getanzt. Warum bei wendischer Folklore auch immer wieder die Annemarie-Polka dieses Nazi-Marschliederkomponisten Herms Niel (Hermann Nielebock) dabei sein muss, verstehe ich bis heute nicht. Aber warum sollte diese Frage nicht Gegenstand einer weiteren Veranstaltung sein?
Der Beitrag ist in der aktuellen Ausgabe des Nowy Casnik auf Niedersorbisch (zum Lesen hier klicken) und auf Deutsch (zum Lesen hier klicken) erschienen.
Zur Tageszeitung Nowy Casnik...
Weltgeschichte und Bilder aus der Provinz. Warum dieses Thema? Warum in der NEUEN BÜHNE Senftenberg?
Referat zur Konferenz „PROVINZ VERSUS PROVINZIALITÄT - 5“, 4. Juni 2015 in Senftenberg
von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
Manchmal führt uns Überraschendes und Nebensächliches, hingeworfen aus einer Laune heraus oder auch als Geistesblitz, gar nicht fort vom Streben, Zusammenhänge immer besser erkennen zu wollen. Walter Benjamin spricht im „Passagen-Werk“ davon, dass es gelte eine Verbindung „zwischen Geistesgegenwart und der ‚Methode‘ des dialektischen Materialismus zu etablieren“ . Damit könnte das Schema eines dogmatischen historischen Materialismus durchbrochen werden, nach dessen Vorstellungen für eine revolutionäre Avantgarde die Aufgabe vor allem darin bestünde, den gesetzmäßig verlaufenden historischen Prozess zu begreifen und aktiv - durchaus auch mittels Revolutionen - zu gestalten. Um Fortschritt ginge es, alles technisch Machbare gelte es deshalb anzuwenden. Das sei zum Nutzen der Menschen. Durchaus spannend erklärt war das alles in dem dicken Buch „Weltall - Erde - Mensch“, das meine Generation noch zur Jugendweihe geschenkt bekam. Wir erinnern uns auch an den Zeitstrahl im Geschichtskabinett der Polytechnischen Oberschule, der Fortschritt nicht einmal als einen spiralförmigen Prozess darstellte, sondern als geradlinigen nach oben weisenden vom tiefen Schwarz der Urgesellschaft unten bis zum Fahnenrot des Kommunismus oben. Die Beherrschung der Natur, rauchende Schornsteine, Eisenbahntrassen, Mais auf unfruchtbarem Acker, künstliche Flussläufe und Seen und die Eroberung des Weltraums waren einige der Symbole für diesen Geschichtsoptimismus. Der erste Mensch im Weltall wurde 1961 als „großer Sieg der Vernunft und der Arbeit“ auf dem Weg in eine helle Zukunft gefeiert.
Und dann aber kommt uns Juri Gagarin mit einer Antwort auf die Frage, wie es denn da oben aussehe, die Plakatmaler den Pinsel aus der Hand fallen lassen mussten: „Dunkel ist es, sehr dunkel, Genossen.“ Wir hören diesen Satz heute Abend in Heiner Müllers „Germania 3“ noch einmal.
Manuel Soubeyrand lässt diesen Satz in seiner Inszenierung jedoch nicht als Schlussakkord stehen, sondern endet mit Bertolt Brecht „An die Nachgeborenen“, so dass die berühmten Stellen daraus nachhallen und so manchen Theaterbesucher nach so viel Zumutung durch das Müller-Stück wieder versöhnlich stimmen könnten:
„Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut
In der wir untergegangen sind
Gedenkt
Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht
Auch der finsteren Zeit
Der ihr entronnen seid.
(…) Ach, wir
Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit
Konnten selber nicht freundlich sein.
Ihr aber, wenn es so weit sein wird
Daß der Mensch dem Menschen Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.“
Nun war Juri Gagarin bestimmt kein Philosoph, so dass Interpretationen seiner Antwort auf die Frage, wie es da oben denn so sei, in diese Richtung fehl am Platze wären. Mit dieser Antwort jedoch bewies Gagarin Geistesgegenwart und hielt sich am Wirklichen und nicht am dogmatischen Anspruch, nicht daran, was die Zeitungen später meinten gehört zu haben. Und es war eine Antwort, die so gar nichts gemein hatte mit dem Streben, jede noch so kleine Episode, Überraschendes oder Nebensächliches, in den durch den Zeitstrahl definierten großen historischen Kontext zu stellen und damit restlos auch dieses zu erklären - als „Abweichendes“ oder „Besonderes“ im Verhältnis bzw. Nichtverhältnis zu den verkündeten allgemeinen Gesetzes des Geschichtsverlaufs.
Walter Benjamin will mit seiner Auffassung von Geschichte weg von dieser eindimensionalen Sicht. Es gäbe so viel Überraschendes zu sehen, nicht bloß durch grübelndes Reflektieren, sondern auch beim Flanieren zum Beispiel. Benjamin glaubte nicht daran, dass wir einem gesetzmäßigen Verlauf der Geschichte ausgeliefert sind. Jedoch sind wir auch nicht nur Zufällen und einer Beliebigkeit von Ereignissen unterworfen. Gegen den Konformismus der (marxistischen) Sozialdemokratie betont er das aktive Moment. Zum Begriff des Fortschritts notiert Benjamin im „Passagen-Werk“: „Für den Dialektiker kommt es darauf an, den Wind der Weltgeschichte in den Segeln zu haben. Denken heißt bei ihm: Segel setzen. Wie sie gesetzt werden, das ist wichtig. Worte sind seine Segel. Wie sie gesetzt werden, das macht sie zum Begriff.“ Gerade hier, beim Begriff von Fortschritt, „hat der historische Materialismus alle Ursache, sich gegen die bürgerliche Denkgewohnheit scharf abzugrenzen. Sein Grundbegriff ist nicht Fortschritt sondern Aktualisierung.“
Wer sich nun aber dieses Denken von Walter Benjamin zu eigen macht, der kommt nicht umhin, „Geistesgegenwart“ als sachgemäße Reaktion auf das Zusammenprallen von Unvorhersehbarem und theoretisch Denkbarem zu begreifen. Benjamin spitzt zu und schreibt: „Entscheidend ist weiterhin, daß der Dialektiker die Geschichte nicht anders denn als eine Gefahrenkonstellation betrachten kann…“ Wir ergänzen: auch wenn der weitgehend definierte Verlauf der Weltgeschichte und Bilder aus der Provinz aufeinander treffen, kann dieser Gedanke von Geschichte als Gefahrensituation aufkommen. Heiner Müllers Stück „Germania 3. Gespenster am toten Mann“ ist eine collagenhafte dramatische Verarbeitung von Ansammlungen solcher Gefahrenkonstellationen. Doch der Gedanke wird von Benjamin weitergeführt, so dass theoretisch Denkbares und die Idee vom selbstbestimmten Handeln gerettet scheinen. Denn, so geht Benjamins Gedanke weiter, der Dialektiker ist jemand, der die Geschichte als Gefahrenkonstellation betrachtet, die er jedoch, „… denkend ihrer Entwicklung folgend, abzuwenden jederzeit auf dem Sprung ist.“ Heiner Müller hat es in einem Diskussionsbeitrag 1981 so auf den Punkt gebracht, dass „Subversion der Kunst … notwendig ist, um die Wirklichkeit unmöglich zu machen.“ Wer dennoch am „Auftrag“ festhält und die Lehrbuchwirklichkeit immer noch als bare Münze betrachtet, der landet eben mit dem Fahrstuhl nach oben irgendwo unten in der Provinz - auf einer Dorfstraße in Peru zum Beispiel.
In der Kunst war es die von Pablo Picasso und Georges Braque Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Collage als bewusstes Ausdrucksmittel, das scheinbar nicht Zusammenpassende eben doch zusammenzubringen. Im Gegensatz zu einigen Lehrbuchmeinungen glaube ich nicht, dass die Collage-Künstler mit ihren Bildern lediglich den Bruch mit tradierten akademisierten Malweisen wollten, die politische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit in der beschriebenen dialektischen Bedeutung erst durch Textcollagen möglich wurde. Denken wir zum Beispiel an das Bild von Kasimir S. Malevič (1879 - 1935) „Ein Engländer in Moskau“ (1913/1914). Natürlich kann man darüber diskutieren oder auch promovieren, ob diese Collage noch viel provokanter geworden wäre, wenn Malevič tatsächlich wie ursprünglich ausgeführt einen echten russischen Holzlöffel auf dem Bild gelassen hätte. Für mich noch interessanter ist, dass hier deutlich wird, dass scheinbar zufällig nebeneinander oder übereinander aufs Bild Gebrachtes eine neue Sicht, einen ungewöhnlichen Zusammenhang ermöglichen lässt. Denn das Provokante und Subversive muss sich nicht schrill an Äußerlichkeiten festmachen, so wie bei der künstlerischen Moskauer Avantgarde vor 1920 mit ihrer alternativen nichteuropäischen Kleidung. „Der Engländer in Moskau“ war nämlich auch ein Vertreter der Moskauer Avantgarde, kein Engländer, sondern der Dichter und Freund von Malevič Aleksei E. Kručënych (1886 - 1968). Im Äußeren immer korrekt, dunkle Anzüge und weiße Hemden. Aber er war es, der besonders radikal das politische System des Zarismus angriff. Er verfasste zum Beispiel 1912 gemeinsam mit Vladimir V. Maâkovskij (1893 - 1930) und anderen das Manifest „Eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack“.
Die Frage war und ist immer wieder: Wie gehen wir damit um, wenn alles gleichzeitig passiert, Äußerliches und Wesentliches nicht zusammenfallen, eingeübte Gewissheiten bröckeln und nichts geordnet ist nach einem Schema, das Fortschritt als ständige Höherentwicklung definieren will? Und was wird aus den Hoffnungen, wenn wieder einmal etwas schief geht?
Manuel Soubeyrand lässt „Germania 3“, anders als bei Heiner Müller, mit der Szene über den Babylonischen Turmbau beginnen. Beim Probenbesuch hat mich das überrascht: Alle Mitwirkenden sitzen auf der Bühnenkante und Soubeyrand choreografiert regelrecht ein harmonisches kollektives Sprechen, das nicht an Babylon und den in Chaos und Katastrophe gescheiterten Turmbau denken lässt. Doch Manuel Soubeyrand hat damit in sinnlich beeindruckender Weise stark betont, was Anliegen auch von Heiner Müller war. Denn trotz der Gleichzeitigkeit von Horror, Revolution, Hoffnung, Unterdrückung, Glück und Katastrophe, es geht immer wieder um den menschlichen Gedanken, einen bis in den Himmel reichenden Turm zu bauen. Das sei das Wesentliche. „Der Gedanke, einmal in seiner Größe gefasst, kann nicht mehr verschwinden…“ Schön optimistisch gesagt von Heiner Müller. Doch dann folgt sogleich Dialektik als Collage, denn bereits die zweite oder dritte Generation, so Heiner Müller, hatte die Sinnlosigkeit des Turmbaus erkannt, hielt aber dennoch am einmal gefassten Beschluss fest. Und dann beginnt das Stück über die hochfliegenden Pläne und gescheiterte Hoffnungen des 20. Jahrhunderts. Das Stück von Heiner Müller selbst, vielleicht noch mehr die unpathetische Inszenierung von Manuel Soubeyrand des teilweise sehr pathetischen Textes, und der Ort - das 1946 in Zeiten des Hungerns maßgeblich von einem sowjetischen Gardeoberst ins Leben gerufene Senftenberger Theater, haben zu den Themen dieser Konferenz geführt. Walter Benjamin und Heiner Müller waren Anregung und auch Provokation, die fünfte Kulturkonferenz der Reihe „Provinz versus Provinzialität“ in dieser Form zu versuchen. In Anlehnung an Bertolt Brecht heißen die zwischen 1986 und 1994 im Verlag der Autoren von Heiner Müller erschienenen Texte, Gespräche und Interviews „Gesammelte Irrtümer“ .
Deshalb: Als Historiengemälde kann diese Konferenz nur scheitern, jedoch erfolgreich scheitern, wenn die Collage gelingt. Und so haben wir vor, über „Gedenken und was wirklich war“, „Geschichten aus der Provinz und wie es sein könnte“ und „Vom kritischen Eingedenken“ zu diskutieren. Außerdem versuchen wir mit der Runde der Kunstmuseumsdirektorin aus Cottbus und Theaterintendanten aus der Provinz noch eins drauf zu setzen, also den Holzlöffel wieder auf das Malevič-Bild zu kleben. Hans-Eckart Wenzel, der radikalste politische Dichterphilosoph, Sänger und Blochianer meiner Generation, hat auf das Begleitheft zu seiner Platte mit schrägen Schlagern, Saufliedern und Schnulzen ein Benjamin-Zitat appliziert, also eine Collage anfertigen lassen. Und so ist dort zu lesen: „‚Die Ordnung des Profanen hat sich aufzurichten an der Idee des Glücks.‘ Walter Benjamin“
Doch sowenig Wenzels „Schnulzen“ unpolitisch sind, so wenig ist das herausgelöste Benjamin-Zitat allein für bare Münze zu nehmen. Denn der gesamte Text, wahrscheinlich 1920/1921 entstanden, führt uns gedanklich eher zu Heiner Müllers „Germania 3. Gespenster am toten Mann“ als dazu, das Zitat in eine Sammlung hübscher Sprüche aufzunehmen. Das macht der Dialektiker Wenzel eben schlau. Wer nur deshalb Bücher liest und sich Vorträge anhört, weil er eine einmal gefasste Meinung lediglich bestätigt haben will, merkt das natürlich nicht.
Bei den bisher genannten Fragen scheint immer wieder eine zentrale Frage auf, nämlich die, ob es nicht doch eine Leitidee, ein Zentrum, eine Metropole geben müsse, um Orientierung für die Ränder - die Provinz und die Peripherie - bieten zu können. Wenn wir nun bereits zum fünften Mal eine Kulturkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung „Provinz versus Provinzialität“ nennen, dann ist hoffentlich klargestellt, dass wir „Provinz“ sehr selbstbewusst verwenden. Auf unserer Collage blitzte immer wieder auf, dass neue Ideen, ein oft schmerzendes und dadurch zu optimistischen Ansätzen taugendes Problembewusstsein sowie theoretische Untersuchungen im Überbaulichen sowie Kreativität und Geistesgegenwärtiges im Praktischen in der vermeintlichen Provinz viel deutlicher zu identifizieren sind als in hektischen und manchmal wichtigtuerischen Metropolen. Es zeigt sich auch, nicht zuletzt in Bürgerinitiativen und beim Leiden unter ungelösten Problemen der „großen Politik“, dass sich die großen Konflikte mitunter am deutlichsten am Rand, in der Provinz, in der Peripherie widerspiegeln. Die Bürgermeisterin der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa Giusi Nicolino hat das mit einem eindringlichen Bild zum Ausdruck gebracht: „Wenn jemand behauptet, dass wir die Peripherie sind, dann braucht er sich nur mal die Landkarte anzusehen: Wir sind genau in der Mitte!“
Sicher, die politische Dimension ist schwer vergleichbar, aber mit einem Perspektivenwechsel könnten der seltsam technokratischen und fortschrittsgläubigen Sicht der Regierenden die erfrischenden und nichtkonformistischen Ideen der Bürgerinitiativen zur Rettung des Altdöberner Sees oder zur Wiederbelebung des Sorbischen/Wendischen in Senftenberg als Alternative zum ewig Üblichen angeboten werden. Doch wir hören die Ermahnung aus Parteibüros und der Landeshauptstadt, auf die Ebene des Sachlichen zurückzukehren. Emotionen würden nicht weiterhelfen. Und es folgt oft noch die Belehrung, dass man das Große und Ganze nicht aus dem Auge verlieren dürfe. Wer bestimmt, was das ist, das Große und Ganze? Oder die „Weltseele“ gar, wenn schon nicht mehr so einfach vom für alle Menschen gleich gültigen Fortschrittsanspruch gesprochen werden soll?
Nicht immer klappt es mit dem Perspektivenwechsel. Vor zwei Jahren bin ich mit großen Erwartungen zur 55. Biennale nach Venedig gereist. Schließlich hatten Frankreich und Deutschland ihre Pavillons getauscht. Damit war, dachte ich, die Idee verbunden, den universellen Charakter von Kunst und Kunstproduktion zu betonen und die Idee vom Wettbewerb der Nationen auf dem Gebiet der Kunst endlich aufzugeben. So waren also die Franzosen im deutschen Nazibau und die Deutschen im französischen Pavillon. In der französischen Ausstellung habe ich mich gelangweilt. In der deutschen dominierte der deutsche Lieblingsdissident Ai Weiwei. Der ist inzwischen zu bedauern, weil durch diese Instrumentalisierung der immer noch gute Künstler Ai Weiwei kaum zur Geltung kommen kann. Das mag meine sehr subjektive Ansicht sein.
Über subjektive Wahrnehmung und Geschmack geht hinaus, wenn 2013 in Venedig konzeptionell der Gedanke des Enzyklopädischen verkündet wird, jedoch in schwabbelig esoterischem Eurozentrismus gefangen bleibt. Um die vielen Handschriften aus so vielen Ländern in der größten Kunstschau der Welt doch noch unter einer Idee zu vereinen, fand man für die Kunstschau die Überschrift „Palazzo Enciclopedio (Enzyklopädischer Palast)“. Ein Turm zur sortierten Aufbewahrung des gesamten Wissens der Menschheit, in den 1950er Jahren gebastelt von einem Karosseriebauer, musste im ersten großen Raum der Arsenale das zentrale Kunstwerk für dieses Konzept hergeben. Und dann noch die Objekte im größten Raum des Zentralpavillons von Carl Gustav Jung und gleich im Nachbarraum von Rudolf Steiner, die präsentiert wurden, als wäre nun endlich die Lösung für das Große und Ganze und die Auflösung der vielen Geistesblitze in einem alles Umfassenden gefunden. Doch hier wurde Interkulturelles zur Exotik, indem die eurozentristische Bewertung der Anderen zur Norm erhoben wurde. Ich gebe zu, es hat mich zusätzlich geärgert, dass der naziaffine Carl Gustav Jung mit seiner Idee von einer Art Weltseele, die für das Enzyklopädiekonzept der 55. Biennale in Venedig als „interkulturelle Klammer“ herhalten muss, gegen Siegmund Freud gewinnen darf. Seine Wandtafelbilder sind jetzt Kunst, nachdem sie als Wissenschaft keine rechte Anerkennung finden wollten.
Ironie und Hoffnung: Die Ausstellung Angolas wurde 2013 als bester Länderbeitrag bewertet. Und die offizielle chinesische Ausstellung empfand ich als ästhetisch interessant und äußerst sozialkritisch. Nichts passte zum Glück ins Schema. Es war interessant in Venedig.
Die 56. Biennale in Venedig in diesem Jahr dürfte als Kontrast zur vorangegangenen gelten. Nicht zuerst deshalb, weil die Rosa-Luxemburg-Stiftung an einem Projekt beteiligt ist, bei dem tagelang aus dem „Kapital“ von Marx vorgelesen wird. Auch nicht, weil alte Probleme mit neuer Schärfe hervorgetreten sind. Ist zum Beispiel der Kunstmarkt durch die in der Wirtschaft herrschenden Globalisierungslogik so stark „bereinigt“, dass nur noch sehr wenige einflussreiche Galeristen bestimmen, was in Venedig gezeigt wird? Wenige bestimmten damit den Welttrend. Wie ist es dann aber um die Freiheit der Kunst bestellt? In diesen Fragen ist wahrscheinlich kein erheblicher Kontrast zwischen 2013 und 2015 festzustellen.
Entscheidend für die Behauptung, dass die Biennale 2015 von wesentlich anderen konzeptionellen Ansätzen ausgeht, waren für mich nicht diese Gesichtspunkte, sondern die Äußerung des künstlerischen Leiters der diesjährigen Biennale Okwui Enwezor, dass es endlich darum gehen müsse, den Begriff der Moderne von westlicher Enge zu befreien. In einem 2014 veröffentlichten Interview formulierte er die Aufgaben des von ihm geleiteten Münchener Hauses der Kunst und sagte zum Beispiel: „Nun haben wir Gelegenheit, das uns vererbte kunstgeschichtliche Modell - die NATO-Version der Kunstgeschichte - zu überdenken.“ Darum geht es, auf das Thema „Weltgeschichte und Geschichten aus der Provinz“ übertragen, wenn wir über kritisches Eingedenken reden. Denn kritisches Eingedenken meint, dass die Sicht der Sieger auf die Geschichte nicht der Maßstab sein dürfe.
Um „Eingedenken“ geht es, nicht bloß um „Einfühlen“. Denn in wen fühlt sich der Geschichtsschreiber des Historismus eigentlich ein? Walter Benjamin dazu: „Die Antwort lautet unweigerlich in den Sieger. Die jeweils Herrschenden sind aber die Erben aller, die je gesiegt haben. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zugut. (...) Wer immer bis zu diesem Tag den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinführt, die heute am Boden liegen.“ Und weiter: „... auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.“ „Die Beute wird (...) im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. (...) Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht (...) Der historische Materialist rückt daher nach Maßgabe des Möglichen von ihr ab. Er betrachtet es als seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten.“
Zur Anregung für die Diskussion und um eine Brücke zu „Germania 3. Gespenster am toten Mann“ zu schlagen zitiere ich an dieser Stelle noch Eduardo Galeano (1940 - 2015). Er schrieb 1991: „Der Westen fühlt sich als Sieger und feiert. Der Zusammenbruch des Ostens hat ihm ein Alibi verschafft: im Osten war es auf jeden Fall schlimmer. War es schlimmer? Eher, denke ich, wäre die Frage zu stellen, ob es wirklich so völlig anders war. Im Westen die Opfertische der Göttin Produktivität: man schlachtet die Gerechtigkeit im Namen der Freiheit. Im Osten die gleichen Altäre, nur dass die Freiheit auf der Strecke bleibt, während man Gerechtigkeit zu realisieren meint.“
Mit diesem Ruf, endlich wach zu werden, ist wohl nicht bloß der Süden gemeint. Denn, so Walter Benjamin: „Erinnerung und Erwachen sind aufs engste verwandt. Erwachen ist nämlich die dialektische, kopernikanische Wendung des Eingedenkens.“
Fußnoten
- Walter Benjamin. Über den Begriff der Geschichte. In: Der.: Gesammelte Schriften. Band I.2. Frankfurt am Main 1991. S. 695
- Walter Benjamin. Passagen-Werk. In: Ders. Gesammelte Schriften. Band V.1. Frankfurt am Main 1991. S. 586
- Комсомольская правда. 13.04.1961. c. 1
- Vgl.: Heiner Müller. Germania 3. Gespenster am toten Mann. Köln 1996. S. 81
- Bertolt Brecht. An die Nachgeborenen. In: Der.: Gedichte. Band IV (1934 - 1941). Berlin/Weimar 1978. S. 150f.
- Walter Benjamin. Passagen-Werk. In: Ders. Gesammelte Schriften. Band V.1. S. 591
- Walter Benjamin. Über den Begriff der Geschichte. A.a.O. S. 695
- Ebenda. S. 587
- Ebenda.
- Heiner Müller. Diskussionsbeitrag auf der „Berliner Begegnung“ vom 13. und 14. Dezember 1981. In: Heiner Müller Material. Leipzig 1989. S. 94
- Vgl.: Heiner Müller. Der Auftrag. Erinnerung an eine Revolution. In: Ders.: Revolutionsstücke. Stuttgart 1995. S. 48ff. - „Der Auftrag“ wurde am Senftenberger Theater zweimal inszeniert, einmal als Projekt während des Umbaus des Theatergebäudes in der Aula der damaligen Ingenieurschule für Bergbau und Energetik „Ernst Thälmann“ 1989, dann noch einmal Ende der 1990er Jahre.
- Vgl.: Felix Philipp Ingold. Im Namen des Autors. Arbeiten für die Kunst und Literatur. Paderborn 2004. S. 244ff. - Zu Malevič vgl. auch: Klaus Hammer. Meister des „Schwarzen Quadrats“. „Kasimir Malewitsch und die russische Avantgarde“ in der Bundeskunsthalle Bonn. In: neues deutschland. 11. Juni 2014. S. 13
- Vgl.: Eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack. Russische Futuristen. Hamburg 2001
- Heiner Müller. Germania 3. A.a.O. S. 68
- Heiner Müller. Gesammelte Irrtümer 1 - 3. Frankfurt am Main 1996
- Wenzel. König von Honolulu (CD). Matrosenblau 2009 - Das Benjamin-Zitat ist entnommen: Walter Benja-min. Theologisch-politisches Fragment. In: Ders. Gesammelte Schriften. Band II.1. Frankfurt am Main 1991. S. 203
- Giusi Nicolino zitiert aus: Anna Maldini. Kein Felsplateau im Nirgendwo. neues deutschland, 25./26.4.2015. S. 20
- Vgl.: Tim Sommer. Wunder im Hirn. In: Biennale Venedig. art spezial. Hamburg 2013. S. 24ff.
- Ich trage nicht die afrikanische Flagge! Okwui Enwezor im Gespräch mit Daniela Roth. In: Magazin der Kul-turstiftung der Länder. Nr 22 - Frühling/Sommer 2014. S. 11
- Walter Benjamin. Über den Begriff der Geschichte. A.a.O. S. 696f.
- Ebenda. S. 695
- Ebenda. S. 696f.
- Eduardo Galeano. Der Weg der ersten Welt. In: Hermann Schulz (Hrsg.). Das Kuckucksei. Wuppertal 1992. S. 185
- Walter Benjamin. Passagen-Werk. In: Ders. Gesammelte Schriften. Band V.2. A.a.O. S. 1058
Zu den Ereignissen in Frankreich: Das war ein Angriff auf ein immer wieder neu einzulösendes Freiheitsideal
Trauer um die Opfer und Aufgaben politischer Bildung
von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
Die der Kommunistischen Partei Frankreichs nahestehende Tageszeitung „L’Humanité“ drückt am 8. Januar 2015 auf schwarzer Titelseite ihre Trauer um ihre Kollegen der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ aus, indem es dort sinngemäß heißt, dass es die Freiheit sei, die mit diesem Attentat ermordet werden soll - „C’est la liberté, qu’on assassine“.
Wer in Frankreich „Freiheit“ („Liberté) sagt, meint in diesem Kontext stets mehr als „Meinungsfreiheit“ oder „Toleranz“. Gemeint sind dann die ursprünglichen Ideale der Französischen Revolution insgesamt: „Liberté, égalité, fraternité“ („Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“). Außerdem sind nicht zuletzt wegen der weiteren Entwicklung der Französischen Revolution die Schwierigkeiten der Freiheit mitzudenken. Mit dem Wissen von heute meint „Freiheit“ dann auch, dass es eben nicht um irgendeinen von einer dominierenden Gruppe oder selbst von der Mehrheit religiös oder national definierten Einheitsbrei gehen kann, sondern um die Anstrengung, ein Leben in Vielfalt als die normale Bewegungsform der menschlichen Gesellschaft zu begreifen und politisch zu gestalten. Islamisten, Pegida und andere Antidemokraten sehen das anders. Mit „Liberté, égalité, fraternité“, diesen ständig neu einzulösenden Idealen der Französischen Revolution, haben sie nichts im Sinn.
Bezeichnend ist, dass sich der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland in seiner Rede zur Konstituierung des neuen Landtages als Alterspräsident auf einen der größten Hasser dieser Ideale, Edmund Burke (1729 – 1797), bezog. Wie Burke nicht zu den dummen Konservativen gehört, so war die Gauland-Rede zwar kein intellektuelles Glanzstück, wie sogar einige linke Abgeordnete meinten, jedoch auch kein plattes rechtsradikales Gebrüll.
Soll allen Antidemokraten dieses trotzige „Je suis Charlie!“ entgegenschallen! Als Ersatz für eine gründliche Auseinandersetzung mit den Ursachen für Terror, Gewalt, „nichtäquivalenter Kriegführung“ und religiösem Fanatismus reicht das jedoch nicht. Auch der komplizierte Zusammenhang, warum islamistischer Terror und Pegida (einschließlich der Unterstützer in AfD und NPD) zwei Seiten einer Medaille sein könnten, wird auf Kundgebungen, und seien sie noch so groß, nicht herauszuarbeiten sein.
Mehrere der ermordeten Journalisten des Satiremagazins hatten auch für die „L’Humanité“ gearbeitet. Heute, am Sonntag nach den Morden, erschien eine Sondernummer dieser Zeitung mit dem Titel: „Contre la haine. LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ“ („Gegen den Hass. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“). Und ebenfalls heute gab es die Verabredung während des Neujahrsbrunchs der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, weiterhin die politische Bildung darauf zu konzentrieren, an die Wurzeln aktueller Erscheinungen vorzudringen und damit Schlussfolgerungen für linkes demokratisches Handeln zu ermöglichen. Mögen politische Reflexe auf schreckliche Ereignisse auch verständlich sein, für mich ist wichtig, dass wir mit den Veranstaltungen des Senftenberger Lausitzbüros und der brandenburgischen Rosa-Luxemburg-Stiftung insgesamt auch weiterhin dem Anliegen einer argumentativen Demokratie verpflichtet bleiben. Darum ging es bei der Gründung der Interessengemeinschaft Dritter Weg Senftenberg wie auch der DDR-Volksbewegung 1989/1990.
Der Auftakt der Europäischen Linken für 2015 in der Berliner Volksbühne machte in beeindruckender Weise deutlich, dass Terrorismus und Krieg sich gegenseitig bedingen. Wer Terrorismus also bekämpfen will, muss auch die Kriege des „Westens“ gegen die „Barbaren“ ablehnen. Und es wird herausragende Aufgabe der Linken bleiben müssen, ständig Kritik an jenen zu üben, die den Terrorismus mit Mitteln bekämpfen wollen, die Teil der Ursachen der Entstehung des Terrorismus sind: Auslandseinsätze, Waffenexporte, Abschottung des „Abendlandes“, Arroganz gegenüber anderen Kulturen, Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche …
Nicht „die westliche Welt“ muss jetzt ihre Werte verteidigen, wie einige Journalisten und europäische Spitzenpolitiker sofort riefen, sondern Menschen aller Kulturen müssen dafür einstehen, dass überall auf der Welt ein Leben in Würde möglich wird. Die Hindernisse für ein solches Leben sind nicht in nationaler Abschottung oder durch „abendländischen“ Überlegenheitstaumel zu beseitigen. Ja, ein erster Schritt kann das Vereintsein in Trauer nach so schrecklichen Taten wie in der vergangenen Woche in Frankreich sein. Zum Eintreten für Menschenwürde gehörte dann jedoch auch, dass es keine Hierarchie der Trauer geben darf. Oder sind die Opfer der Boko-Haram-Terrormilizen im Norden Nigerias oder die durch Drohnenangriffe getöteten Hochzeitsgesellschaften in Afghanistan von geringerem Interesse, weil nicht zur "westlichen Wertegemeinschaft“ gehörend? „Charlie Hebdo“ übrigens hätte diese Frage nicht so harmlos gestellt.
Dass Denkweisen mit tief sitzendem Rassismus bei vielen Menschen, von ihnen selbst oft unbemerkt, ihren Platz haben, zeigt sich in Reden wie „obwohl er Muslim ist, kamen alle mit ihm aus“. Die französische Philosophin Simone Weil (1909 – 1943) hat diese Haltung bereits während ihres Deutschlandaufenthaltes 1932 am Beispiel eines verinnerlichten Antisemitismus selbst bei Linken beobachtet.
Selbstverständlich sind die Akteure der Rosa-Luxemburg-Stiftung tief betroffen von den Ereignissen, den Morden, in Frankreich. Wir sind traurig und wütend. Jedoch, das allein reicht nicht. Außer Empathie, dem Wärmestrom, wie Bloch es nannte, muss auch ein kühler Kopf, die Analyse, dazu kommen. Darum geht es in der politischen Bildung. Nicht zuerst um spektakuläre oder publikumswirksame Veranstaltungen kann es gehen, sondern vielmehr um Beharrlichkeit und einen langen Atem, um politische Bildung langfristig gegen Politikmüdigkeit, die sich immer mehr als Demokratiemüdigkeit erweist, in Anschlag zu bringen. Denn, um mit Herbert Marcuse auf die Ausgangsüberlegung zurückzukommen, Tatsache ist, „dass Freiheit unvereinbar ist mit Unwissenheit.“
Links:
Das Recht auf Anderssein - Philosophische und praktisch-politische Überlegungen zur Sorben/Wenden-Politik in Brandenburg
Vortrag auf der Tagung "Das Recht auf Perspektive - Regionalentwicklung bei indigen Völkern, europäischen Minderheiten und den Sorben/Wenden" am 6.12.2014 in Cottbus
von Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann
Einleitung
„Was rechtens sei? – darum kommt man nicht herum. Diese Frage läßt immer aufhorchen, sie drängt und richtet. Ein als naturrechtlich bezeichnetes Denken hat sich ihr gewidmet, grundsätzlich, nicht von Fall zu Fall“ (Bloch 1985, S.11). So beginnt Ernst Bloch sein im Jahre 1961 veröffentlichtes Werk „Naturrecht und menschliche Würde“.
Es ist eine banale Feststellung, dass ein Mensch sich von anderen Menschen durch Anderssein unterscheidet und es sich hierbei um ein Recht im philosophischen Sinne Ernst Blochs als Naturrecht handelt. Das Recht auf Anderssein ist damit eine Selbstverständlichkeit und dem positiven Recht, dem schriftlich fixierten und alltäglich anzuwendenden, übergeordnet. Übergeordnet nicht in einer formalrechtlichen Bedeutung, dass es als fixierter Gesetzestext hierarchisch über allen anderen daraus lediglich zu deduzierenden Fragen „Was rechtens sei?“ steht. Es ist ein unveräußerliches, eigentliches, Recht und steht damit der Tendenz entgegen, möglichst alles lückenlos in Gesetzen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen schriftlich zu regeln. „Wo alles veräußerlicht wurde, stechen unveräußerliche Rechte sonderlich heraus“ (ibid.). Die Konsequenzen für aktuelles politisches Handeln auch nur zu denken, die sich aus diesem Bloch-Satz ergeben, bereitet durchaus Schwierigkeiten.
Denn erstens ergibt sich die Frage, ob dieses wesentlich auf Individualrechte zielende Denken ebenso für Kollektive gelten soll. Im Falle der Sorben/Wenden wäre damit die Frage verbunden, wie diese Gruppe dann zu definieren sei. Müssen sie, um als Kollektiv anerkannt zu werden, autochthon bleiben und in einem per Gesetz festgelegten Gebiet wohnen? „Was rechtens sei? – darum kommt man nicht herum. Diese Frage läßt immer aufhorchen, sie drängt und richtet. Ein als naturrechtlich bezeichnetes Denken hat sich ihr gewidmet, grundsätzlich, nicht von Fall zu Fall“ (Bloch 1985, S.11). So beginnt Ernst Bloch sein im Jahre 1961 veröffentlichtes Werk „Naturrecht und menschliche Würde“.
Es ist eine banale Feststellung, dass ein Mensch sich von anderen Menschen durch Anderssein unterscheidet und es sich hierbei um ein Recht im philosophischen Sinne Ernst Blochs als Naturrecht handelt. Das Recht auf Anderssein ist damit eine Selbstverständlichkeit und dem positiven Recht, dem schriftlich fixierten und alltäglich anzuwendenden, übergeordnet. Übergeordnet nicht in einer formalrechtlichen Bedeutung, dass es als fixierter Gesetzestext hierarchisch über allen anderen daraus lediglich zu deduzierenden Fragen „Was rechtens sei?“ steht. Es ist ein unveräußerliches, eigentliches, Recht und steht damit der Tendenz entgegen, möglichst alles lückenlos in Gesetzen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen schriftlich zu regeln. „Wo alles veräußerlicht wurde, stechen unveräußerliche Rechte sonderlich heraus“ (ibid.). Die Konsequenzen für aktuelles politisches Handeln auch nur zu denken, die sich aus diesem Bloch-Satz ergeben, bereitet durchaus Schwierigkeiten.
Denn erstens ergibt sich die Frage, ob dieses wesentlich auf Individualrechte zielende Denken ebenso für Kollektive gelten soll. Im Falle der Sorben/Wenden wäre damit die Frage verbunden, wie diese Gruppe dann zu definieren sei. Müssen sie, um als Kollektiv anerkannt zu werden, autochthon bleiben und in einem per Gesetz festgelegten Gebiet wohnen?
Und zweitens geht es selbstverständlich auch in der Demokratie um Macht. Doch, so schreibt der französische Philosoph Jacques Rancière in seiner ersten von zehn Thesen zur Politik: „Man spart die Politik von vornherein aus, wenn man sie mit der Ausübung der Macht und dem Kampf um deren Besitz gleichsetzt“ (Rancière, 2008, S. 7). Demokratie ist so verstanden „also keineswegs eine politische Herrschaftsform“ (Ibid, S. 19), unter der sich das Volk mit beschlossener Einheitlichkeit versammelt. Demokratie sei die Einsetzung der Politik selbst – „die Einsetzung ihres Subjekts und ihrer Form der Beziehung“ (ebenda). Und diese Beziehung sei durch Dissens und nicht durch Konsens gekennzeichnet.
Ins Politische moderat übersetzt könnte das heißen, die Vielfalt – der damit verbundene Streit, der Dissens usw. - ist die normale Bewegungsform der Gesellschaft, für die die Demokratie als Politik den Rahmen bilden sollte. Das ist ein wichtiger Gedanke für die Anwendung der gegenwärtig gültigen rechtlichen Regelungen und politischen Vereinbarungen in der Minderheitenpolitik. Auf den ersten Blick mag das provokant erscheinen. Wer jedoch Minderheitenpolitik bzw. Förderung der autochthonen Minderheiten so versteht, dass dabei die Minderheiten im Kollektiv wie als Individuen Subjekte dieser Politik sein sollen, versteht auch, dass es sich um keine leicht zu lösende Aufgabe handelt. Denn Demokratie, auf die Gewinnung von Mehrheiten im Interesse stabilen politischen Handelns angewiesen, muss hier auf Machtausübung in gewisser Weise verzichten. Demokratische Minderheitenpolitik bedeutet demnach, auf die Macht der größeren Zahl an dieser Stelle bewusst zu verzichten. Und es bedeutet, auf ein der Politik entgegengesetztes Prinzip zu verzichten. Rancière nennt dieses entgegengesetzte Prinzip „Polizei“. Dieses zähle nur die durch Unterschiede definierten Gruppen von Menschen „unter Ausschluss jedes Supplements“ (ebenda, S. 29). Was durch Konsens dann herauskommen kann, ist „die Annullierung des Dissens“ und damit „die Annullierung der überschüssigen Subjekte“ (ebenda, S. 45).
Auf das Heute in der Sorben/Wenden-Politik der Bundesrepublik Deutschland gemünzt bedeutet dieser theoretische und, wie sich hoffentlich zeigen lässt, ebenfalls sehr praktisch-politische Ansatz ein Plädoyer gegen die Verrechtlichung und Vergeldlichung des Politischen, in besonderer Weise gegen die Verrechtlichung und Vergeldlichung in der Kulturpolitik des Landes Brandenburg (Hoffmann 2007, S.48ff). Sorben/Wenden-Politik ist aus dieser Perspektive mehr als Kulturförderung im Sinne von Projektförderung, wo, grob gesagt, nur zählt, was sich zählen lässt. Hier geht es um Kulturpolitik in einem umfassenden Sinne, vor allem darum, dass Kulturpolitik keine Ordnungspolitik („Polizei“) ist. Es geht um die durchaus gegensätzlichen Fragen, was gezählt werden soll und was oder wer zählt. Im Verhältnis von Naturrecht im beschriebener philosophischer Bedeutung und positivem Recht wird Dissens hervortreten (zum Thema Naturrecht bei Bloch siehe Dietschy et al. 2012, S.360ff). Doch auch hier zählt die Idee vom Supplement, denn allgemeines Naturrecht findet sich mit starker appellativer Kraft im Grundgesetz, Artikel 1 (1) positiv aufgehoben wieder: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ (Bundestag 2012).
Weiter im Tagungsband ...
Verpflichtung zur Pflege sowjetischer Gedenkstätten
Gedanken und Anregungen von Gerd-Rüdiger Hoffmann
Aufgrund einer Anfrage von Torsten Jurasik, dem Vorsitzender des Ortsverbandes Senftenberg der Partei DIE LINKE, vom 30. April 2012 hat Gerd-Rüdiger Hoffmann, MdL, seine Überlegungen zur Verpflichtung zur Pflege und Instandhaltung von sowjetischen Gedenkstätten in einem Positionspapier formuliert.
Einigungsvertrag und Kulturpolitik im Land Brandenburg. Ein Kommentar
Studie von Gerd-Rüdiger Hoffmann
In der Einführung der Studie heißt es:
„Kultur“ gehört zu den unscharfen Begriffen in der Wissenschaft und ist natürlich politisch belastet. Kulturpolitik – so scheint es – kümmert sich wenig um kulturwissenschaftliche Debatten oder gar um kulturphilosophische Fragestellungen. Der Umstand, dass wir es in allen Debatten – ob nun in der Politik oder in der Wissenschaft - mit unscharfen Begriffen zu tun haben, ist nicht zu beklagen. Denn bereits Aristoteles wusste, dass der Begriff von einem Gegenstand nicht schärfer sein kann als der Gegenstand selbst. Manchmal ist es gut, dass Kultur nicht so eindeutig zu definieren ist, jedenfalls nicht als Zustand.
Wenn es dann allerdings um rechtsverbindliche Verträge gehen soll, die Kultur zum Gegenstandhaben, dann wird es mit einem unscharfen Begriff kompliziert.
In diesem Kommentar zu einem konkreten Gegenstand, nämlich dem „Artikel 35: Kultur“ im Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands aus dem Jahre 1990, ist nicht der Platz, um alle Dimensionen des Kulturbegriffs zu erklären. Aber ein Punkt ist wichtig und kann als Prämisse für alle Überlegungen gelten: Es geht, wenn heute von Kultur die Rede ist, um das tätige, das gestaltende Element im Verhältnis der Menschen zueinander, zur Natur und zur bereits geschaffenen Kultur. Es steckt im Begriff drin, dass Menschen nicht dazu da sind, sich Sachzwängen oder technologischen Prozessen bloß unterzuordnen, sondern im Gegenteil, Produktion und Verkehr nach menschlichem Maß zu formen. Mit diesem Ansatz ergibt sich ganz klar, dass Kulturpolitik Kernaufgabe für politische Gestaltung in demokratisch verfasster Gesellschaft sein muss und Kultur und Arbeit zusammen gehören. Hier waren Erfahrungen und Traditionen des Kulturverständnisses aus DDR-Zeiten zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Einigungsvertrages durchaus noch wirkmächtig. Auch die Erwartungshaltung, dass Kultur von staatlicher Seite zu fördern sei, war selbst bei kritischen Künstlerinnen und Kulturarbeitern tief verwurzelt. Dieses Verständnis wirkt bis heute nach. Aber: Arbeit und Kultur wie das Verhältnis von Freiheit von Kunst und staatliche Förderung von Kunst und Kultur gestalten sich nicht einfach nur spannungsreich in einem akademisch-dialektischen Sinne. Ich will nur daran erinnern, dass 1996 ein Kulturparteitag der PDS Brandenburg von 1500 Bergleuten besetzt wurde, weil die Gewerkschafter der Meinung waren, dass erstens der Kampf zur Rettung des kleinen Dorfes Horno vor den Kohlebaggern ihre Arbeitsplätze gefährdet und zweitens die Partei sich mit wichtigeren Dingen als mit der Kultur im Lande beschäftigen sollte. DIE LINKE selbst ist gelegentlich anfällig für ein solches Denken, dass Kultur als das betrachtet, was danach kommt – nach den vermeintlich wesentlichen Dingen des Lebens. Doch wer Programme zu Wahlen oder Leitbilder der LINKEN genau liest, wird merken, dass es sich bei diesen Dokumenten insgesamt um kulturpolitische Programme handelt.
Denn es geht irgendwie immer darum, was das Leben in diesem Land zukünftig ausmachen soll. Das ist für mich Kultur. Unser Bestreben muss dahin gehen, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass Veränderungen wie sinkende Einwohnerzahlen nicht zwingend weniger Kultur(ausgaben) erfordern, sondern die Bedeutung der Kultur mit ihren bildenden und sozialen Funktionen wachsen wird, ohne Kultur lediglich instrumentell als Sahnehäubchen für politische Zwecke benutzen zu wollen. Es geht nicht um die Frage, ob wir uns unter diesen Bedingungen noch Kultur, also Kunst und Kulturförderung, leisten können, sondern welche komplizierter werdenden Aufgaben Kulturpolitik zu leisten hat. Der Ständigen Kulturpolitischen Konferenz beim Parteivorstand ist es vor allem zu danken, dass in der Partei ein Verständnis von Kultur entwickelt wurde, das einen weiten Kulturbegriff zur Grundlage hat und dennoch nicht ins Abstrakte abgleitet.
Auf dem Cottbuser Parteitag der LINKEN am 6. Juli 2008 wurde dieser Ansatz in einer Erklärung eindrucksvoll bestätigt. In der jetzt gestarteten Diskussion um ein Parteiprogramm ist im ersten Entwurf davon nichts mehr zu erkennen. Lediglich in der Präambel ist das Spannungsverhältnis der Herkunft aus zwei unterschiedlichen Kulturen – Ost und West – Thema. Sich unter diesen Aspekten mit dem Einigungsvertrag von 1990 zu beschäftigen, scheint mir eine lohnende Aufgabe zu sein.